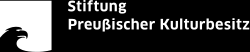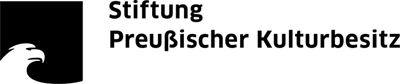Bereichsnavigation
Kultur und Außenpolitik: Was Museen mit Diplomatie zu tun haben
News vom 11.04.2016
Im April lässt sich das Auswärtige Amt in die Karten schauen. Wir sprachen vorab mit Dr. Andreas Görgen, Leiter der Kultur- und Kommunikationsabteilung des Amtes, über die Zukunft der auswärtigen Kulturpolitik.

Sie soll internationale Krisen mildern und Kooperationen initiieren – auswärtige Kulturpolitik, die „dritte Säule“ der Außenpolitik. Dass Letztere längst nicht mehr jenseits des Schlagbaums beginnt, möchte das Auswärtige Amt vom 13. bis 15. April 2016 im Forum „Menschen bewegen“ zeigen. In Sonderaktionen an über einem Dutzend Berliner Kunst-, Kultur- und Wirtschaftsorten stellt es dabei seine Arbeit und zentrale Fragen zur kulturellen Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert vor.
Herr Görgen, warum richten Sie eine solche Veranstaltungsreihe hier in Berlin aus?
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) ist in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint, wichtiger denn je. Seit seiner ersten Amtszeit sieht Außenminister Steinmeier sie deshalb als einen außenpolitischen Schwerpunkt an. Das setzen wir mit dem Forum „Menschen bewegen“ in Berlin fort. Wir wollen die Bedeutung der AKBP im Inland noch stärker sichtbar machen und noch besser die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Partner hier in Berlin einbinden. Das gilt natürlich im besonderen Maße für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ja selbst einer der großen internationalen Player der Kulturpolitik ist!
Welche Rolle spielen Museen in der Außenpolitik?
Museen spielen als Orte außerschulischen Lernens für die AKBP eine ganz zentrale Rolle, sie sind – um es mit dem Soziologen Ray Oldenburg zu sagen – sogenannte Third Places, also Orte nicht nur des Wissenstransfers, sondern auch der sozialen Interaktion, der Meinungsbildung und des Wertediskurses. Wir binden deshalb gezielt auch die Berliner Museen in die Lange Nacht der Ideen ein, um dort in der Zusammenarbeit von Innen und Außen zu zeigen, dass wir gemeinsame Fragen in einer gemeinsamen kulturellen Arbeit stellen und so besseren Antworten zuführen können. Ich freue mich sehr, dass wir Hermann Parzinger als Mentor für einen Workshop im Neuen Museum gewinnen konnten. Dabei wird es um die Frage gehen, wie Schönheit in unterschiedlichen kulturellen Räumen und angesichts sich wandelnder Wertevorstellungen wahrgenommen wird.
Orte wie die Museumsinsel oder das zukünftige Humboldt Forum präsentieren große außereuropäische Sammlungen und setzen in ihrer täglichen Arbeit verstärkt auf Kooperationen mit den Herkunftsländern. Wie wirkt sich das auf die auswärtige Kulturpolitik aus?
Sehr! Denn es geht in der auswärtigen Kulturpolitik ja gerade um die grenzüberschreitende kulturelle Koproduktion und Aufbereitung von Wissen und Kultur. Wir müssen wieder mehr von dem verstehen, was sich an Träumen und Traumata in Gesellschaften niederschlägt, und das daraus entstehende kritische Potential für uns selbst nutzbar machen. Außenminister Steinmeier hat dies mit dem Begriff der kulturellen Intelligenz umschrieben, die es zu stärken gilt. Insofern sehe ich viel Potential zwischen der Arbeit speziell der Berliner Museen und unserer außenkulturpolitischen Arbeit. Lassen Sie mich als Beispiele nur die gemeinsamen Bemühungen zwischen SPK, Goethe-Institut und Auswärtigem Amt nennen. Hier geht es darum, einen Diskurs auf Augenhöhe zwischen In- und Ausland für das Humboldt Forum zu fördern, um die gemeinsamen Bemühungen um internationale Ausstellungsprojekte und nicht zuletzt um den Rat, den Professor Parzinger uns auf gemeinsamen Reisen mit dem Außenminister zuteilwerden lässt.
Internet und Digitalisierung bieten völlig neue Möglichkeiten, die Welt kennenzulernen und mit anderen Gesellschaften auch persönlich in Kontakt zu treten. Was bedeutet das für die auswärtige Kulturpolitik und Kulturinstitutionen, welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie?
Internet und Digitalisierung bieten ein enormes Potential für gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme und damit auch für den Zugang zu Wissen und Kultur. Die darin liegenden Chancen auch für die grenzüberschreitende museale Arbeit gilt es zu nutzen. Gleichzeitig bringt die internetbasierte Kommunikation wieder neue Fallstricke hervor. Deshalb ist es eine der Herausforderungen für die AKBP, Wege zu finden, wie sie die Koproduktion von Wissen und Kultur sowie den Dialog der Gesellschaften unter diesen veränderten Bedingungen mitgestalten kann. Außerdem wollen wir einen kritischen Diskurs sowie eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft ermöglichen. Wie das gehen kann, wollen wir bei der Langen Nacht der Ideen mit dem Workshop „Nervöse Systeme / Data Detox“ im Haus der Kulturen der Welt diskutieren.
Grundlegend für funktionierende Dialoge ist auch die Frage, wer wie und wann spricht. Wie kommt man von einer Ansprache zu einem interkulturellen Dialog auf Augenhöhe? Sind die Erfahrungen aus der auswärtigen Kulturpolitik auch für Museen in Deutschland von Nutzen?
Der Erfolg der auswärtigen Kulturpolitik liegt darin begründet, dass wir die Eigengesetzlichkeit der kulturellen und wissenschaftlichen Arbeit respektieren und stärken. Die AKBP arbeitet seit der Weimarer Republik mit unabhängigen Mittlerorganisationen, die seit Jahrzehnten weltweit hervorragende Arbeit im vorpolitischen Raum leisten und so glaubhaft dazu beitragen, dass die Diplomatie der Kultur und Wissenschaft an manchen Stellen weiter gehen kann als die Diplomatie selbst. Auf diese Weise tragen wir zu einem interkulturellen Dialog bei, der auf Verstehen, Verständnis und im bestmöglichen Fall auf Verständigung abzielt. Den Blick für den anderen zu entwickeln und die daraus entstehenden Erfahrungen für die eigene Arbeit fruchtbar zu machen, also wegzukommen von reiner Repräsentation von Wissen und Kultur hin zu grenzüberschreitendem Austausch und gemeinsamer Arbeit, wird zunehmend auch die museale Arbeit in Deutschland prägen. Dabei wollen wir unterstützen und helfen.
Die Fragen stellte Silvia Faulstich