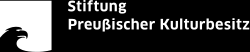Bereichsnavigation
Welfenschatz – kein NS-Raubgut
Pressemitteilung vom 29.05.2009
Im Berliner Kunstgewerbemuseum wird der Welfenschatz bewahrt, der größte deutsche Kirchenschatz im Eigentum einer öffentlichen Kunstsammlung. Der preußische Staat hat ihn 1935 von einem Händlerkonsortium angekauft. Im Januar 2008 fragten erstmals Erben dieser Händler, die jüdischen Glaubens waren, über ihren Anwalt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach den Erwerbsumständen. Ein offizielles Restitutionsbegehren stellten sie im April 2008. Die Anspruchsbegründung enthielt Angaben, die über den damals vorhandenen Wissensstand bei der Stiftung hinausgingen und intensive Recherchen notwendig machten. Heute hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz dem Anwalt der Anspruchsteller mitgeteilt:
„Nach den gegenwärtig bekannten Umständen hält die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Voraussetzungen für eine Restitution des Welfenschatzes an die Erben der Kunsthändler, die ihn 1935 an die Dresdner Bank für die Überlassung an die preußischen Staatlichen Museen zu Berlin verkauft haben, nicht für gegeben.“
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagt: „Zu diesem Ergebnis ist die Stiftung gekommen, nachdem sie sich sehr gründlich mit dem Restitutionsbegehren und der Erwerbungsgeschichte zum Welfenschatz befasst hat. Sollten in Zukunft Unterlagen ermittelt werden, die eine neue Betrachtung des Falles notwendig erscheinen lassen, werden wir diese ebenso sorgfältig prüfen.“
Der Welfenschatz
Der im Berliner Kunstgewerbemuseum bewahrte Bestand des „Welfenschatzes“ umfasst 44 Werke der Schatzkunst aus dem 11. bis 15. Jahrhundert, vor allem Reliquiare und Tragaltäre. Unter ihnen befinden sich zahlreiche Objekte von höchstem kunstgeschichtlichem Rang. Kein anderer deutscher Kirchenschatz spiegelt die Entwicklung der Goldschmiedekunst des Mittelalters in vergleichbar umfassender Weise. Seinen Ursprung hatte der „Welfenschatz“ in dem einstigen Reliquienschatz der Stiftskirche St. Blasius in Braunschweig. Da er aber im Mittelalter über Jahrhunderte durch zahlreiche Stiftungen der welfischen Landesherren und Kirchenpatrone vermehrt wurde und sich seit dem 17. Jahrhundert über nahezu 260 Jahre auch im unmittelbaren Besitz des Welfenhauses befand, trägt er heute den Namen „Welfenschatz“.
In den frühen 1920er Jahren versuchte das Herzogshaus erfolglos, den Schatz zur Geldbeschaffung zu verkaufen. Nachdem diese ersten Verkaufspläne gescheitert waren, wurden die damals noch 82 Objekte des Welfenschatzes im Oktober 1929 von einem Konsortium Frankfurter Kunsthändler gekauft. Bald danach wurden „Verkaufsausstellungen“ des Schatzes in Frankfurt am Main, Berlin und in mehreren Städten der USA veranstaltet und 40 Stücke an verschiedene Museen und Privatsammler veräußert. Mitte 1935 kaufte die Dresdner Bank als Treuhänderin für den Preußischen Staat den verbliebenen Bestand des Welfenschatzes für das zu dieser Zeit im Berliner Schloss angesiedelte (und deshalb „Schlossmuseum“ genannte) Kunstgewerbemuseum. Zwei weitere Stücke wurden später hinzu erworben.
Die Stellungnahme der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat in ihrem heutigen Schreiben an den Anwalt der Antragsteller unter Berücksichtigung der Grundsätze der Washingtoner Prinzipien von 1998 sowie der „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 1999 die bisher recherchierten Fakten und Umstände dargelegt und bewertet. Zusammengefasst stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar:
- Es kann keinen Zweifel geben, dass alle Konsorten rassisch verfolgt waren und deshalb auch erhebliche Vermögensverluste erlitten. Mit Blick auf das Welfenschatz-Geschäft muss aber vor dem Hintergrund der ermittelten Umstände eine andere Einschätzung gelten.
- Wesentlichen Ausschlag für den Verkauf des Welfenschatzes zum bekannten Zeitpunkt und zu den bekannten Konditionen an die Dresdner Bank gab nach Auswertung der Unterlagen die Tatsache, dass die Konsorten mit dem Ankauf im Jahr 1929 eine enorme Investition getätigt hatten, die dann wegen des schwachen Marktes nicht zu den erhofften Weiterverkäufen führten. Sowohl der Ankauf des Schatzes als auch seine Vermarktung erforderten außergewöhnliche finanzielle Anstrengungen. Vor 1933 konnten weniger als die Hälfte der Objekte verkauft und nur ein Teil des Ankaufspreises wieder eingenommen werden. Dadurch befanden sich die Konsorten schon vor 1933 unter starkem wirtschaftlichem Druck.
- Nach der Aktenlage war der preußische Staat 1935 weltweit der einzige Verkaufsinteressent. In den Vertragsverhandlungen wurde kein unzulässiger Druck zur Erzwingung eines für Preußen günstigen Verhandlungsergebnisses ausgeübt. Zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen befand sich der Welfenschatz außerhalb Deutschlands und unterlag nicht dem Zugriff deutscher Stellen.
- Der im Vertrag vom 14. Juni 1935 vereinbarte Kaufpreis von 4,25 Mio. Reichsmark stand nicht im Missverhältnis zu den Erlösen, die das Konsortium mit den vor 1933 erfolgten Verkäufen von Teilen des Welfenschatzes erzielt hatte, sondern bewegte sich auf einem entsprechenden Niveau.
- Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Kaufvertrag nicht in allen Punkten so wie vereinbart erfüllt worden ist, dagegen deutliche Hinweise, dass sich Preußen vertragstreu verhalten hat.
Preußen hat - am 17. Juli 1935 von der Dresdner Bank schriftlich bestätigt - die mit 4,25 Mio. RM vereinbarte Kaufpreiszahlung vereinbarungsgemäß an die Dresdner Bank gezahlt.
Es war vereinbart, dass das Konsortiumsmitglied Saemy Rosenberg für einen Teil dieser Summe (778.125 RM) Kunstwerke in Deutschland erwerben und exportieren konnte. Dies war notwendig, um trotz der bestehenden Devisenbestimmungen Verbindlichkeiten der Konsorten im Ausland abgelten zu können. Nachweislich hat Rosenberg für 678.125 RM Werke aus den Sammlungen der Staatlichen Museen erworben und ausgeführt. Es handelte sich um hochwertige Stücke, deren Wiederverkaufswert 678.125 RM deutlich überstieg.
Über den verbleibenden Zahlbetrag von über 3,3 Mio. RM sollten die Firma Z. M. Hackenbroch und über einen weiteren Betrag von 100.000 RM Herr S. Rosenberg der Dresdner Bank Zahlungsanweisung geben. Diese Beträge standen nach der Zahlung Preußens an die Dresdner Bank den Konsorten zur Verfügung. Ob und wie sie die Beträge abgerufen haben, ist nicht belegt. Aus den Entschädigungsverfahren von Hackenbroch ergeben sich aber Hinweise darauf, dass in den Jahren 1935 und 1936 Einnahmen bei seiner Firma verbucht wurden, die aus dem Verkauf des Welfenschatzes stammten.
In den Entschädigungsverfahren der Konsorten in den 1950er Jahren wurde weder vorgetragen noch geltend gemacht, dass der Welfenschatzvertrag verfolgungsbedingt zustande gekommen oder nicht wie vereinbart erfüllt worden ist. Zum Zeitpunkt dieser Verfahren war der Welfenschatz bereits dauerhaft in öffentlichen Museen ausgestellt – zunächst ab 1953 in Niedersachsen, seit 1963 in Berlin.
Auf der Grundlage umfangreicher Unterlagen hat die SPK die Fakten und Zusammenhänge auf der Basis der „Handreichung“ bewertet. Dabei wurde geprüft, ob die früheren Eigentümer verfolgt waren und ob sie nach 1933 einen Vermögensverlust erlitten haben. In diesem Fall gilt grundsätzlich die Vermutung, dass der Verlust verfolgungsbedingt stattgefunden hat. Widerlegt werden kann diese Vermutung, indem aufgezeigt wird, dass die Anspruchsteller einen fairen Preis erhalten haben und über diesen auch frei verfügen konnten.
Verfolgung der beteiligten Personen und Firmen
„Diese steht hier außer Zweifel, alle Konsorten waren jüdisch und den bekannten Repressalien ausgesetzt.“
Als Verkäufer trat in dem Kaufvertrag vom Juni 1935 ein so bezeichnetes „Konsortium“ aus Kunsthändlern auf, dem angehörten:
- die Firma Z.M. Hackenbroch, Frankfurt a.M.,
- die Herren I. Rosenbaum und S. Rosenberg, Amsterdam, als frühere Inhaber der Firma I. Rosenbaum o.H.G., Frankfurt,
- die Firma I. und S. Goldschmidt, Frankfurt a.M..
Die Firma Hackenbroch wurde zum Zeitpunkt des Kaufes des Welfenschatzes von Zacharias Max Hackenbroch und seinem Neffen Herbert Bier als Prokurist geführt. Im August 1935 erhielt Bier ein Berufsverbot. Hackenbroch sollte die Tätigkeit ebenfalls untersagt werden, es gelang ihm aber, dies zunächst abzuwenden. Im April 1937, etwa zwei Jahre nach Abschluss des Vertrages, wurde Z.M. Hackenbroch die Berufsausübung verboten, er starb im August desselben Jahres in Frankfurt. Die Firma wurde im Februar 1938 gelöscht. Bier verließ 1936 Deutschland, die Witwe und die Töchter Hackenbrochs reisten ca. 1938 nach London aus.
Die Firma Jakob Rosenbaum oHG war ein Frankfurter Familienunternehmen. Geschäftsführer zum Zeitpunkt des Ankaufs des Welfenschatzes 1929 waren Isaak Rosenbaum und Saemy Rosenberg. Aus den Entschädigungsakten geht hervor, dass sich die Firma Rosenbaum bereits Anfang der 30er Jahre in finanziellen Schwierigkeiten befand. Ende 1934 wanderten Saemy Rosenberg und Isaak Rosenbaum unter Zahlung der damit verbundenen Zwangsabgaben aus Deutschland in die Niederlande aus, wo sie die Rosenbaum N.V. gründeten und weiter im Kunsthandel tätig waren. Die Geschäfte der 1934 liquidierten Firma Jakob Rosenbaum oHG wurden ab 1934 in Deutschland durch die J. Rosenbaum GmbH weitergeführt, die allerdings nicht an dem Welfenschatz-Geschäft beteiligt war. Die Vertragsverhandlungen zum Welfenschatz hat insbesondere Rosenberg, und zwar teilweise das gesamte Konsortium vertretend, selbst geführt und ist dazu auch aus Amsterdam nach Deutschland gereist.
Über die Geschichte und Rechtsverhältnisse der Firma I. und S. Goldschmidt ist nur wenig bekannt. Vom Anwalt der Anspruchsteller wurde mitgeteilt, dass der am 18. November 1964 in London verstorbene Julius Falk Goldschmidt bis zu seinem Tod ihr Alleininhaber war. Die Firma soll nur pro Forma in den Kaufvertrag über den Welfenschatz aufgenommen und von den übrigen Konsorten zu diesem Zeitpunkt schon ausbezahlt gewesen sein. Julius Falk Goldschmidt betrieb unter dem Firmennamen „The Goldschmidt Galleries, Inc.“ in New York einen Kunsthandel, über den der wesentliche Teil der amerikanischen Verkäufe erfolgt ist.
Die Firmen bzw. deren Inhaber unterlagen auch nach der Abwicklung des Welfenschatzvertrags Repressalien, die allerdings nach Einschätzung der SPK nicht im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen.
Vermögensverlust
„Von den möglichen Verlustszenarien kommt hier nur ein Zwangsverkauf in Frage. Die Tatsache des Verkaufs an sich kann hier allerdings, anders als bei anderen Verkäufen, noch kein Indiz für einen unfreiwilligen Verlust sein. Anders als Sammler, die Kunst erwarben, um sie dauerhaft zu behalten, waren die Konsorten Kunsthändler, die die Objekte gerade kauften, um sie weiterzuveräußern.“
Geprüft wurde, ob die staatliche Verfolgung zumindest ein ausschlaggebender Grund dafür war, dass das Rechtsgeschäft mit dem Staat als Käufer über den Welfenschatz zustande kam. Weiter wurde geprüft, ob die Konsorten wegen ihrer Verfolgung in ihrer Willensentscheidung beim Verkauf eingeschränkt waren.
Aus den vorliegenden Unterlagen lässt sich erkennen, dass es zum Verkaufszeitpunkt 1935, und wohl bereits seit Mitte 1931, keinen anderen ernsthaften Kaufinteressenten als den deutschen oder preußischen Staat gab. Schon vor 1933 hatten die Konsorten große Schwierigkeiten, Käufer für den Schatz zu finden. Kurz nach dem Ankauf boten sie ihn 1930 zunächst dem Reich an. Da der Staat trotz erheblicher Lobbyarbeit aus Museums- und Kirchenkreisen den Kauf ablehnte, wurden in Frankfurt und Berlin Ausstellungen organisiert, die aber nur zu einem ernstzunehmenden Angebot – von dem Leiter des Cleveland Museum of Art – führten. Insbesondere zeigten die großen Museen weltweit keinerlei Interesse. In den Jahren 1930/31 wurde der Schatz von dem Konsortium in mehreren Ausstellungsstationen in Amerika gezeigt. Das Museum in Cleveland kaufte schließlich wichtige Stücke, als Spitzenwerk den Getrudistragaltar; weniger bedeutende Objekte wurden von einem Museum in Chicago angekauft. Keines der anderen amerikanischen Museen zeigte Interesse, wohl auch wegen der wirtschaftlich schlechten Lage. Daneben gelang es den Konsorten im selben Zeitraum, weitere, weniger bedeutsame Objekte an einzelne Sammler aus Europa und Amerika zu verkaufen. Der erzielte Verkaufspreis lag nach Literaturangaben bei insgesamt ca. 2,5 Mio. RM. 42 Stücke konnten nicht verkauft werden, darunter bedeutende Objekte, insbesondere das Kuppelreliquiar, das Hauptwerk des Schatzes. Die nicht verkauften Objekte wurden nach Europa zurückgebracht. Über weitere konkrete Verkaufsbemühungen des Konsortiums ist bis Herbst 1933 nichts bekannt.
Erst nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam wieder Bewegung in die Ankaufsverhandlungen. Der Wechsel zu einer nationalsozialistisch beherrschten Politik ließ es möglich erscheinen, den Staat dafür zu gewinnen, die nicht unbeträchtlichen Finanzmittel für einen Ankauf aufzubringen. Spätestens im Herbst 1933 wurden dazu erste Kontakte zwischen Zacharias Hackenbroch und Adolf Feulner, dem Direktor des Frankfurter Kunstgewerbemuseums, aufgenommen. Der Verlauf der Verhandlungen, auch hinsichtlich der daran unmittelbar beteiligten Personen, ist nur unvollkommen in erhaltenen Dokumenten belegt. Dem Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gelang es offenbar, sich für dieses Ziel Rückendeckung beim Preußischen Ministerpräsidenten, Hermann Göring, zu verschaffen, und schließlich auch den Preußischen Finanzminister, Johannes Popitz, davon zu überzeugen.
Es gibt keinen Hinweis, dass die Konsorten durch staatliche Zwangsmaßnahmen, wie sie aus anderen Fällen bekannt sind, dazu genötigt worden wären, den Schatz 1935 an Preußen zu verkaufen. Die noch nicht verkauften Teile des Schatzes befanden sich 1935 in Amsterdam. Einzelne Mitglieder des Konsortiums hatten Geschäftsbetriebe außerhalb Deutschlands, ab 1934 auch in Amsterdam, von wo aus sie einen Verkauf mit jedem Interessenten hätten vorbereiten und durchführen können.
„Die Initiativen, die Möglichkeiten eines Verkaufs an den deutschen oder preußischen Staat zu sondieren, die nach den Unterlagen spätestens im Herbst 1933 unter aktiver Beteiligung von Zacharias Hackenbroch begonnen wurden und spätestens im Frühjahr 1934 die preußischen Ministerien sich damit befassen ließen, einen Kauf des Welfenschatzes ins Auge zu fassen, gingen nicht von diesen Ministerien aus. Immerhin belegen die nur rudimentär erhaltenen Akten, dass in diesen Ministerien erhebliche Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, den Ankauf für realisierbar zu halten.“
Nach der Aktenlage standen die Konsorten teilweise aber unter wirtschaftlichem Druck. Für die Bewertung des Rückgabebegehrens wäre dieser insoweit von Bedeutung, als er durch Verfolgungsmaßnahmen und vor dem Abschluss des Kaufvertrages am 14. Juni 1935 entstanden und für den Abschluss bestimmend gewesen wäre.
Die Firma I. Rosenbaum und S. Rosenberg oHG wurde im Jahr 1934 liquidiert und als Jakob Rosenbaum GmbH um- oder neu gegründet. Es gibt – auch in den Entschädigungsakten der Firma J. Rosenbaum – keine Hinweise darauf, dass die zur Liquidation führende wirtschaftliche Situation der Firma erst nach dem 30. Januar 1933 entstanden ist. Schlechte Wirtschaftsergebnisse dieser Firma sind schon für die Jahre vor 1933 belegt, insbesondere enthält die Entschädigungsakte den Hinweis „die Firma war konkursreif“. Auch die Firma von Zacharias Hackenbroch befand sich bereits vor 1933 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Geschäftsbücher aller Konsortialfirmen sind zwar nicht mehr erhalten, wie in den Entschädigungsverfahren vorgetragen wurde. In einem dieser Verfahren schildert aber Herbert Bier, der Prokurist von Hackenbroch, dass ihm 1932 die ihm zustehenden jährlichen Zinserträge von etwas mehr als 1.000 RM aus seiner Kapitalbeteiligung an der Firma nicht ausbezahlt werden konnten, weil die Firma nicht zahlungsfähig war.
Eine nicht unerhebliche Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten aller an dem Konsortium Welfenschatz beteiligten Firmen dürfte in dem Ankauf des Welfenschatzes selbst liegen. Dieser Ankauf erwies sich spätestens nach dem Ergebnis der Verkaufsausstellungen 1930/31 in den USA deutlich als kaufmännische Fehldisposition. Die verbliebenen 42 Objekte des Welfenschatzes, für die kein Käufer gefunden werden konnte, wurden auch deshalb zu einer wirtschaftlichen Belastung der Konsorten, weil alleine die Verwahrung dauernde Aufwendungen (Unterbringung, Bedienung von Krediten) erforderte.
Dass selbst die mit den Verkäufen 1931 erlösten insgesamt 2,5 Mio. RM den Druck nicht minderten, liegt sicherlich auch an dem durch keine bekannten Unterlagen aufklärbaren Binnenverhältnis der Konsorten. Offenbar haben die übrigen Konsorten die Beteiligung von Julius Falk Goldschmidt schon vor 1935 abgelöst. Diese Ablösung dürfte den wirtschaftlichen Druck bei ihnen beträchtlich erhöht haben. Vermutlich bestanden auch nicht unerhebliche Verbindlichkeiten der Konsorten gegenüber weiteren in- und ausländischen Beteiligten, von denen unter anderem in dem Kaufvertrag vom 14. Juni 1935 ausdrücklich die Rede ist. Adolf Feulner berichtet zudem, die Konsorten hätten ihm mitgeteilt, der Welfenschatz sei „im Ausland gekauft [worden], und zwar durch ausländisches Kapital unter Beteiligung des deutschen Kunsthandels“. Über die Identität der Kapitalgeber ist nichts weiter bekannt. Ebenfalls nicht bekannt ist, welche vertraglichen Regelungen im Zusammenhang mit dem Ankauf 1929 vom Welfenhaus wie auch im Zusammenhang mit dem Verkauf an die Dresdner Bank die Konsorten untereinander getroffen hatten.
Fairer Preis
Der Marktwert des Welfenschatzes ist nur schwer feststellbar, da der Schatz nur für einen sehr begrenzten Kreis überhaupt von Interesse war. Umso bedeutender ist daher für die Bewertung der Angemessenheit des Verkaufspreises, wie sich die Preisvorstellungen von Käufer und Verkäufer zueinander verhielten und mit welchen Mitteln das schließlich einvernehmliche Ergebnis erzielt wurde. Von den Händlern selbst sind keine Dokumente bekannt, die ihre Vorstellungen über den Kaufpreis aufzeigen. Über die Einzelheiten der wohl nach Mitte 1934 beginnenden Vertragsverhandlungen ist auch sonst nur wenig bekannt.
Adolf Feulner, der Direktor des Frankfurter Kunstgewerbemuseums, schrieb am 3. Februar 1934: „Über die Höhe der heutigen Forderung ist nichts bekannt. Die Frankfurter Herren habe mir gelegentlich mündlich mitgeteilt, dass sie den Ankaufspreis jedes einzelnen Stückes gerne bekannt geben und – für den Fall, dass ernsthaft an einen Ankauf gedacht würde – würden sie auch unter den Ankaufspreis heruntergehen.“ Mittelbare Angaben findet man auch in Briefen des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. In dem Brief vom 14. Juli 1934 an das preußische Staatsministerium heißt es: „Bei dieser Gelegenheit darf ich darauf hinweisen, dass die von Ihnen als heutige Forderung des Händlerkonsortiums genannte Summe von 7 Millionen RM. - soweit ich unterrichtet bin - nicht mehr den wirklichen Verhältnissen entspricht. Die bisher von verschiedenen Stellen geführten Verhandlungen haben ergeben, dass die Eigentümer des Welfenschatzes diesen für eine weit geringere Summe, d.d. etwa für 4 bis 5 Millionen RM abzugeben bereit wären.“ Am 31. Oktober 1934 heißt es in dem Brief an das preußische Finanzministerium, das noch von dem Kauf überzeugt werden musste: „Der Handelswert dieses Bestandes unterliegt den Schwankungen des Kunstmarktes wie auch des allgemeinen Wirtschaftslebens. Mit 6 bis 7 Millionen Reichsmark wird er gegenwärtig nicht zu hoch veranschlagt sein. Da indessen die Verkaufsaussichten der geschlossenen Sammlung jetzt ungünstig sind und eine zu dem Händlerkonsortium gehörende Firma sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet, wäre die Zeit für einen Gesamtankauf durch den Staat zu einem bedeutend geringeren Preise außerordentlich günstig.“ Das am 14. Juni 1935 feststehende Ergebnis der Verhandlungen entsprach schließlich der zwischen dem Finanzminister und der Dresdner Bank abgesteckten Verhandlungslinie, mit einer Korrektur um 150.000 RM nach oben.
An dieser Stelle hat die SPK einen Vergleich zur Summe, die die Händler selbst für den Schatz bezahlt hatten, gezogen. Zur Ankaufssumme gibt es verschiedene Aussagen. Als verlässlichste Angabe erscheint der Betrag von 8 Mio. RM, der in dem Text „Der Reliquienschatz des Hauses Braunschweig-Lüneburg (Welfenschatz) vom 17. bis 20. Jahrhundert“ von Klaus Jaitner im Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 1986 genannt wird. Gesicherte Zahlen liegen derzeit nicht vor, weil Stillschweigen darüber vereinbart worden war.
Die vor 1933 aus dem Welfenschatz erfolgten Verkäufe und der Verkauf 1935 ergeben einen Erlös von insgesamt 6,75 Mio. RM für das Konsortium. Diese Summe entspricht etwa 85 Prozent des 1929 von dem Konsortium an die Welfen gezahlten Preises, wenn man von 8 Mio. RM ausgeht.
Erheblich ist auch, dass es im Zeitraum von 1929 bis 1935 eine deutliche Deflation gegeben hat, sodass das allgemeine Preisniveau 1935 bei ca. 80 Prozent der Preise von 1929 liegt. Berücksichtigt man dies, so liegt der Gesamterlös nicht wesentlich unter dem Ankaufspreis.
Der 1935 vereinbarte Kaufpreis von 4,25 Mio. RM war auch nicht unverhältnismäßig niedrig gegenüber dem bei früheren Verkäufen insgesamt erzielten Erlös von 2,5 Mio. RM. Bei den früheren Verkäufen spielte die Verfolgung keinesfalls eine Rolle. Das Hauptwerk des Welfenschatzes, deutlich wertvoller als jedes andere Objekt, ist das Kuppelreliquiar, das von Preußen gekauft wurde. Bereits 1930 war es dem deutschen Reich von den Konsorten für 2,4 Mio. RM angeboten worden. Ansonsten bestanden die Konvolute beider Verkäufe zu etwa gleichen Teilen aus herausragenden und weniger bedeutenden Stücken. Dies macht deutlich, dass der in Deutschland 1935 gezahlte Preis in derselben Größenordnung lag wie der in den Jahren 1930/31 erzielte Erlös.
„Soweit der Preis sich gegenüber den ersten Erwartungen der Konsorten als niedrig darstellt, dürfte hierfür ein wesentlicher Faktor sein, dass der Preußische Staat, wie oben ausführlich dargestellt, der einzige Kaufinteressent war. In dieser Situation einen „guten“ Preis auszuhandeln entspricht auch sonst durchaus im Kunsthandel der Praxis und ist nicht grundsätzlich verwerflich. Auch konnten die Konsorten bei dieser Marktlage sicher nicht hoffen, noch einen Gewinn zu erzielen.“
Auch die Vertragsgestaltung spricht dagegen, dass bei den Vertragsverhandlungen die Notlage der Konsorten in verwerflicher Weise ausgenutzt und ein Vertrag diktiert worden ist. Der Vertrag enthält detaillierte Regelungen und Sicherungsmechanismen für die Konsorten, die dafür sprechen, dass ernsthafte Verhandlungen stattfanden. Ein Beispiel dafür ist die Zahlung des für Saemy Rosenberg bestimmten Teils des Kaufpreises (778.125 RM) in Kunstwerken, wodurch die – sonst wegen der Devisenbestimmungen problematische – Abfindung ausländischer Beteiligter der Konsorten ermöglicht wurde. Dem Konsortium war ein Rücktrittsrecht vom gesamten Vertrag eingeräumt für den Fall, dass keine Einigung über diese Stücke erzielt würde. Auf dieses Rücktrittsrecht verzichtete Rosenberg „unter der Voraussetzung, dass die Ausfuhr der aus den Staatlichen Museen erworbenen Gegenstände in der vorgesehenen Weise vonstatten geht“ ausdrücklich, so dass er mit der vereinbarten Auswahl der Kunstwerke einverstanden gewesen sein dürfte.
Freie Verfügung über den Kaufpreis
Für die Beantwortung der Frage, ob die Konsorten den vereinbarten Kaufpreis erhalten haben und über ihn verfügen konnten, reicht nach der Handreichung der Anscheinsbeweis aus. Das bedeutet, wenn ein Sachverhalt nach der Lebenserfahrung bzw. nach historischen Erkenntnissen auf einen bestimmten typischen Verlauf oder ein typisches Ergebnis hinweist, muss nur dieser Sachverhalt bewiesen werden. Das Ergebnis wird dann auch als bewiesen betrachtet.
Für die preußische Regierung trat die Dresdner Bank als Treuhänder auf. Warum diese Konstruktion gewählt wurde, ist bisher nicht geklärt. Es könnte damit zusammenhängen, dass zwischen der Dresdner Bank und dem preußischen Staat weitere Geschäfte mit Kunstbezug abgewickelt wurden. Die Überweisung ist durch die Anweisung des Finanzministers an die Staatsbank zur Zahlung der Summe an die Dresdner Bank belegt, ebenso durch ein den Eingang bestätigendes Schreiben der Dresdner Bank vom 17. Juli 1935. Die Akte über die Abwicklung des Vertrags ist bei der Dresdner Bank nicht mehr aufzufinden.
Eindeutig belegt ist, dass die für 678.125 RM aus den Staatlichen Museen ausgewählten Kunstwerke Saemy Rosenberg erreicht haben. Die Stücke befinden sich heute größtenteils in ausländischen Museen, die sie von Rosenberg angekauft haben. Beispielhaft können zwei Werke genannt werden: Das Gemälde „Hl. Magdalena“ von Crivelli, über das Hackenbroch schrieb, dass man erwarte, es für etwa „300“ (Tausend) RM entweder an Thyssen oder an Mannheimer zu verkaufen. Tatsächlich kaufte der Amsterdamer Bankier Mannheimer das Bild, das sich heute im Rijksmuseum Amsterdam befindet. Das Metropolitan Museum erwarb 1937 die an Rosenberg überlassene Französische Steinmadonna über einen Zwischenhändler für 75.000 Dollar (etwa 300.000 RM). Es war vereinbart, dass Rosenberg für 778.125 RM Kunstwerke in Deutschland auf dem freien Kunstmarkt und aus dem Bestand der Staatlichen Museen erwerben und exportieren konnte. Zu den verbleibenden 100.000 RM gibt es keinerlei Hinweise. Belegt ist aber, dass Preußen den vollen Betrag von 778.125 RM auf das Sperrmarkkonto bei der Dresdner Bank gezahlt und nur die mit den Kunstwerken der Staatlichen Museen verrechneten 678.125 RM zurückerhalten hat.
Der größte Teil des Preises, 3,3 Mio. RM, war an die Firma Z.M. Hackenbroch zu vergüten. Aus den erhaltenen Akten ergibt sich kein eindeutiger Beleg für eine Überweisung oder Auszahlung an Hackenbroch. Allerdings ist in einer Aktennotiz vom 9. Juli 1935 (unterzeichnet von der Dresdner Bank und von Saemy Rosenberg für das Konsortium) festgehalten, dass die Firma Hackenbroch über die ihr zustehende Summe der Dresdner Bank „laut separatem Brief Zahlungsanweisung erteilen wird“. Rechtlich war also die Firma Hackenbroch bereits verfügungsberechtigt. In der Entschädigungsakte Clementine Cahn/Hackenbroch ist ein Hinweis enthalten, dass die Umsätze der Firma Hackenbroch in den Jahren 1935 und 1936 nur deshalb „noch verhältnismäßig erheblich“ gewesen seien, weil die Beteiligung an dem Welfenschatz verkauft worden sei. Die angegebenen Geschäftsumsätze sind deutlich höher als in den Vorjahren. Zwar handelt es sich hier nicht um Eingänge von 3,3 Mio. RM, jedoch ist davon auszugehen, dass Hackenbroch die Summe für das gesamte Konsortium entgegennahm und diese nicht insgesamt für seine Firma bestimmt war. Zu vermuten ist, dass daraus auch die ausländischen Kapitalgeber für den Ankauf 1929 bedient wurden. In den Entschädigungsakten wird auch mitgeteilt, dass die Geschäftsunterlagen „verbombt“ worden seien; sie liegen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht vor.
Weitere 100.000 RM waren als „Provision“ an einen im Vertrag nicht näher benannten „Deviseninländer“ zu zahlen. Hierzu ist in der Aktennotiz vom 9. Juli 1935 festgehalten, dass Saemy Rosenberg der Dresdner Bank eine Zahlungsanweisung geben sollte. Ob diese erteilt wurde, ist nicht bekannt.
In keinem der bisher vorliegenden Dokumente der unmittelbar beteiligten Konsorten, von denen Goldschmidt 1964 und Saemy Rosenberg erst 1970 starb, wurde auch nur angedeutet, dass der Vertrag einschließlich der Zahlungen nicht wie vereinbart abgewickelt wurde. Auch in den Entschädigungsakten von Frau Hackenbroch, S. Rosenberg und der Firma I. Rosenbaum findet sich kein Hinweis, dass die Kaufpreiszahlung nicht erfolgt wäre.
„Mit Blick auf den in Kunstwerken zu entrichtenden Teil des Kaufpreises ist also, soweit Stücke aus den Museen gekauft wurden, eindeutig belegt, dass die Vertragsabwicklung ordnungsgemäß erfolgt ist. Für die Zahlung an Hackenbroch gibt es deutliche Indizien. Dagegen gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Vertrag in Teilen nicht ordnungsgemäß abgewickelt worden wäre, obwohl solche ggf. zu erwarten gewesen wären. Es gibt hier also einen bewiesenen Sachverhalt, aus dem typischerweise folgt, dass die Zahlung erfolgt ist. Dieser erbrachte Anscheinsbeweis wäre durch die Antragssteller zu erschüttern, in dem greifbare Anhaltspunkte dafür aufgezeigt werden, dass die Zahlung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist.“
Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich also deutliche Hinweise darauf, dass die Konsorten die Vergütung erhalten haben und darüber auch frei verfügen konnten. Soweit der Kaufpreis in Kunstwerken beglichen wurde, sind diese nachweislich ausgeführt worden, über diese konnten die Konsorten zweifellos frei verfügen. Für Hackenbroch gibt es in den Entschädigungsakten keinen Hinweis, dass die Firma mit Blick auf die Einnahme aus dem Welfenschatz z.B. mit einer besonderen Abgabe belegt worden wäre oder ähnliches. Es deutet also alles darauf hin, dass Hackenbroch über den Betrag, den er für seine Firma beanspruchen konnte, auch im Rahmen des Geschäftsbetriebs frei verfügen konnte. Auch insofern kann also die Vermutung des verfolgungsbedingten Verlustes widerlegt werden.
Es gibt hier also einen bewiesenen Sachverhalt, aus dem typischerweise folgt, dass die Zahlung erfolgt ist und die Konsorten darüber auch frei verfügen konnten. Dieser erbrachte Anscheinsbeweis wäre durch die Antragssteller zu erschüttern, indem greifbare Anhaltspunkte dafür aufgezeigt werden, dass die Zahlung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist.
Restitutionen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekennt sich zu den 1998 verabschiedeten Washingtoner Prinzipien (Principles of the Washington Conference With Respect to Nazi-Confiscated Art). Gemäß einem Beschluss des Stiftungsrats von 1999 ist der Präsident der Stiftung befugt, direkt mit den Rechtsnachfolgern jüdischer Eigentümer über einvernehmliche Lösungen zu verhandeln. Die Stiftung hat seitdem in 29 Fällen über Restitutionsbegehren entschieden. 22 dieser Rückgabeersuchen wurde entsprochen, weitere Fälle sind derzeit in Bearbeitung. Darüber hinaus werden die Sammlungsbestände der Stiftung in systematisch-wissenschaftlicher Form im Hinblick auf ihre Herkunft sukzessive weiter erforscht und die Ergebnisse dieser Recherchen öffentlich gemacht.