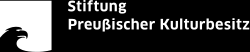Ans Bauhaus angelehnt
News from 04/26/2019
We apologize that this content is available in German only.
„Visuelle Systeme“ – so heißt eine neue gemeinsame Veranstaltungsreihe von Kunstbibliothek und Staatsbibliothek. Den Anfang machte vor vollem Saal Gestaltungskoryphäe Bernard Stein. Mit uns sprach er darüber, wie er sich an interessante Dinge „anlehnt“, was das Bauhaus ihm bedeutet und wie sich Gestaltung im Laufe der Zeit verändert hat.

Herr Stein, wie sind Sie zur Gestaltung gekommen und zu den Sachen, die Sie heute machen?
Bernard Stein: Eher unbeabsichtigt. Ich habe fast nie einen Plan gehabt, dass ich Das oder Das dann und dann machen oder erreichen will. Aber natürlich habe ich mich öfter gefragt: „Wie ticke ich eigentlich?“ Heute könnte ich rückblickend sagen, ich lehne mich in Richtungen, die mich interessieren. Das können Personen wie Lehrer oder Freunde sein oder Themen wie Gestaltungsforschung oder Weitergabe. Mein aktuelles Projekt, das Archiv für Historische Abbildungspraxis, ist so etwas, wohin ich mich zur Zeit lehne: Ich habe keine ganz klare Vorstellung davon, wohin ich will. Aber ich merke, dass es mich genug interessiert, um kontinuierlich daran zu arbeiten. Dabei finde ich dann schon raus, was mich interessiert, und das gestalte ich dann. Am Anfang steht also meist „das Lehnen“ und irgendwann folgt daraus „das Gestalten“ – wenn alles gut geht.
Ist das Bauhaus zum Beispiel etwas, woran Sie sich lehnen?
In jedem Fall gestalterisch, aber auch auf eine bestimmte Art biografisch: Während meines Studiums gab es ein grösseres Studienprojekt bei Prof. H. W. Kapitzki für ein kulturelles Erscheinungsbild. Nur drei Studenten und er. Es ging um das Bauhaus-Archiv, das damals noch in Charlottenburg im heutigen Bröhan-Museum war. Einer der anderen Studenten war Nicolaus Ott und wir haben bei der Arbeit gemerkt, dass wir ganz gut zusammenarbeiten können. Wir sind zwar sehr unterschiedlich und gucken die Sachen ganz unterschiedlich an, aber eben so unterschiedlich, dass wir uns aneinander anlehnen konnten. Wir sind dann für 25 Jahre zusammengeblieben. Dabei war unser Dialog über Entwurf und Gestaltung das Herzstück unserer gemeinsamen Arbeit.
Spiegelt sich dies auch in Ihrer Lehre wider?
Auch in der Lehre halte ich den Dialog mit den Studierenden für das Wesentliche. Dabei gibt es natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das Interessante ist gemeinsam herauszufinden, was der jeweilige Zugang zur Gestaltung ist, und den Einzelnen darin zu stärken. Natürlich gilt es dabei ein Qualitätsbewusstsein zu entwickeln. Für eine Qualität, die nicht nur gefordert wird, sondern auch als Richtschnur dient, um das eigene Gestalten zu beurteilen.
Sie sind seit den 70er-Jahren als Gestalter tätig. Wie hat sich Gestaltung im digitalen Zeitalter verändert?
Das Digitale ist zum Zugang zur Gestaltung geworden. Bis in die 1990er war Gestaltung in seinen technisch/handwerklichen Aspekten Fachleuten vorbehalten. Eine Farbbearbeitung vorzunehmen, eine Sachdarstellung anzufertigen oder ein anständiges Satzbild zu erstellen erforderten eine Ausbildung. Gestaltung wurde als „gestalten können“ begriffen. Heute können alle, die mit einem Rechner umgehen können, damit auch gestalten, und Gestaltung wird mehr zu dem, was sein Wesen ausmacht: dem Bilden von Gemeinschaften. Und das wird noch zunehmen.
Die Fragen stellte Jonas Dehn.