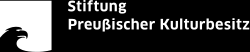Bereichsnavigation
Symposium am 11. und 12. Dezember 2008 in Berlin. „Verantwortung wahrnehmen. NS-Raubkunst – Eine Herausforderung an Museen, Bibliotheken und Archive“
Pressemitteilung vom 11.12.2008
Einführungsvortrag von Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: „Wege zu mehr Verantwortung. Vom Umgang mit NS-Raubkunst 10 Jahre nach Washington“ - Es gilt das gesprochene Wort -
Die Vorgeschichte
Öffentliche Museen, Bibliotheken und Archive in Deutschland tragen seit jenen dunklen Tagen der nationalsozialistischen Herrschaft in unserem Land eine besondere Verantwortung bei der Wiedergutmachung des unfassbaren Unrechts, das insbesondere Mitbürgern jüdischen Glaubens widerfahren ist. Sie stellen sich dieser Verantwortung, indem sie Kunst- und Kulturgüter restituieren, die jüdischen Eigentümern verfolgungsbedingt entzogen worden waren.
Die Verfolgung der Juden in Deutschland hat eine lange Geschichte und beginnt nicht erst 1933 mit der Machtergreifung Hitlers. Antisemitismus äußerte sich in unserem Land immer wieder durch gesellschaftliche Ausgrenzung und auch durch staatliche Zwangsmaßnahmen gegen Juden. Besonders ab dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit führten Privilegien jüdischer Geldverleiher, für die das Zinsverbot nicht galt, und andere vorgeschobene Anlässe zu Anfeindungen, die sich auf die gesamte jüdische Bevölkerung entluden. Unverständnis und Intoleranz gegenüber dem Glauben und der damit verbundenen Lebensweise der Juden, aber auch Neid und Mißgunst gegenüber ihrem Bildungs- und Vermögensstand ergaben zu nahezu allen Zeiten immer wieder vergleichbare Zerrbilder.
Im Jahre 1812 wurden die im Königreich Preußen lebenden Juden zwar zu preußischen Staatsbürgern, allerdings mit zahlreichen Einschränkungen. Erst 1871 erklärte die neue Reichsverfassung alle deutschen Juden zu gleichberechtigten Bürgern, zumindest dem Gesetz nach. Dennoch war damit der gesellschaftliche Antisemitismus nicht beseitigt, und immer wieder brach er sich einen Weg, insbesondere in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. So schrieb die antisemitische Propaganda jüdisch-revolutionären Kräften die Schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg und am Zusammenbruch des Kaiserreichs zu.
Die Weimarer Republik brachte zwar einerseits weitere gesetzliche Verbesserungen für Juden, wie freie Berufs- und Schulwahl, andererseits kam es zu einer deutlichen Verschärfung antisemitischer Attacken. So warben z. B. etliche Kur- und Badeorte an der Ostsee oder in Bayern schon vor 1933 damit, „judenfrei“ zu sein. Ferner sei an das Schicksal des jüdischen Philosophen Theodor Lessing erinnert, Privatdozent an der TH Hannover, der 1926 aufgrund eines kritischen Artikels gegen Hindenburg auf Druck der nationalistisch geprägten Studentenschaft beurlaubt worden war; im August 1933 ermordeten ihn dann die Nazis. Bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten existierte also bereits eine latente Bedrohung alles Jüdischen, und die neue Reichsregierung entwickelte daraus in den folgenden 12 Jahren auf perfide Weise eine bis zur völligen Vernichtung gehende Strategie.
1933 war eben nicht das Jahr Null für den Beginn des jüdischen Mitbürgern zugefügten Unrechts, auch wenn sich danach eine ganze staatliche Maschinerie in den Dienst von Antisemitismus und Judenvernichtung stellte. Die Frage nach der Rolle öffentlicher Museen, Bibliotheken und Archive ist deshalb auch auf die Zeit vor 1933 auszudehnen. Bei der Aufarbeitung von Einzelfällen kann dieser Aspekt sogar von beträchtlicher Bedeutung sein.
Die Berliner Museen entwickelten sich seit ihrer Gründung 1830 zu Orten der Kunst, Kultur und Wissenschaft von Weltrang mit herausragenden Sammlungen. Dass sie diese Stellung in vergleichsweise kurzer Zeit erreichen konnten, verdanken sie in nicht unwesentlichem Maße der Großzügigkeit jüdischer Mäzene. Für andere Museen in Deutschland gilt dies gleichermaßen. Namen wie James Simon, Eduard Arnhold, Oskar Huldschinksy u. v. a. sind mit der Geschichte der Berliner Museen so eng verbunden wie Ludwig Darmstaedter und Martin Breslauer mit der Preußischen Staatsbibliothek. Die Liste ließe sich unschwer fortführen.
Jüdische Bürger, die durch den wirtschaftlichen Aufschwung der Gründerzeit im Waren- und Geldhandel wie auch in freien Berufen als Ärzte und Rechtsanwälte zu Wohlstand gekommen waren, sahen es als ihre religiöse wie auch moralische Pflicht an, zu helfen und einen Teil ihrer Einkünfte karitativen und kulturellen Zwecken zu widmen. Die jüdischen Privatsammler waren großzügige Leihgeber und Schenker, Förderer und Berater, deren Unterstützung öffentliche Museen und Bibliotheken gerne in Anspruch nahmen. Das Jahr 1933 brachte auch hierin eine tiefgreifende Zäsur.
Die Staatlichen Museen zu Berlin waren – wie andere Kultureinrichtungen in Deutschland – Teil des Systems und beteiligten sich ab 1933 an den Raubzügen des nationalsozialistischen Staates auf der Suche nach Kunstwerken in jüdischem Besitz. Das Zusammenspiel von Museen, Bibliotheken und Archiven und den nationalsozialistischen Behörden, die die Beschlagnahme jüdischen Eigentums durchführten, verlief planmäßig. Grundlegend war dabei, dass jüdische Bürger seit April 1938 nach einer Anmeldeverordnung ihr gesamtes Vermögen offenlegen und den Behörden melden mussten, um eine „Abwanderung von Kulturgut“, wie es im Nazi-Jargon hieß, zu verhindern. Das Umzugsgut auswanderungswilliger Juden wurde von Sachverständigen nach wertvollen Kunstgütern durchforstet, wobei hochrangige Museumsmitarbeiter sowie Kunsthändler mitwirkten: auch der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek und der Direktor des Preußischen Geheimen Staatsarchivs.
Diese sog. Sachverständigen waren nicht zwangsläufig immer fanatische Nationalsozialisten, doch sie sahen sich vielfach institutionell in den Arisierungsprozess eingebunden. So wurde z. B. Hanfstaengl als Direktor der Nationalgalerie 1935 per Dienstanweisung gezwungen, Kunst, die als „entartet“ galt, zu vernichten. Dies betraf auch Werke aus der Sammlung Littmann in Breslau. Littmann wurde ab 1933 systematisch an seiner Anwaltstätigkeit gehindert und beging schließlich 1934 Selbstmord. Seine Erben gaben 1935 Teile seiner umfangreichen Kunstsammlung in eine Auktion bei Max Perl. Hier beschlagnahmte die Gestapo 64 Werke als „entartet“ und brachte sie zur Vernichtung in die Nationalgalerie Berlin. Hanfstaengl konnte nur weniges retten, die meisten Arbeiten verbrannten in der Heizungsanlage des Kronprinzenpalais.
Anders als Hanfstaengl gab es aber auch aktive Mittäter, wie z. B. Hans Posse, der damalige Direktor der Dresdner Gemäldegalerie, der sich ganz in den Dienst der nationalsozialistischen Kulturpolitik stellte. Die staatlichen Kultureinrichtungen profitierten dabei sehr bewusst von der Not und dem Zwang, dem die jüdischen Mitbürger ausgesetzt waren. Sie erwarben in Auktionen oder direkt von den Sammlern beträchtliche Bestände wertvoller Werke und Konvolute oft weit unter Wert zur Aufwertung der eigenen Sammlungen. Die Washingtoner Grundsätze sind deshalb – nach den Rückerstattungs- und Wiedergutmachungsverfahren in den 1950er Jahren – ein notwendiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit.
Die Washingtoner Grundsätze
Genau vor zehn Jahren, nämlich vom 30. November bis zum 3. Dezember 1998 wurde die internationale „Konferenz über Holocaust-Vermögenswerte“ im Holocaust-Museum in Washington abgehalten. Veranstalter waren das amerikanische Außenministerium unter der Schirmherrin Madeleine Albright, seinerzeit US-Außenministerin, und das United States Holocaust Memorial Museum.
Die Washingtoner Konferenz galt als Fortsetzung jener Gespräche, die bereits ein Jahr zuvor in London abgehalten wurden. Vom 2. bis 4. Dezember 1997 war dort auf Einladung der britischen Regierung über die Arbeit der sog. „Dreiseitigen Goldkommission“ diskutiert worden. Diese war 1946 in Paris gegründet worden, bestand aus England, Frankreich und den USA und hatte die Aufgabe, das noch vorhandene und nachweisbare monetäre Gold zusammenzutragen, welches das Deutsche Reich in den Banken der besetzten und eroberten Staaten eingezogen hatte. Diese Aufgabe war 1997 so gut wie abgeschlossen, und das sichergestellte Gold hatte man an die Gläubigerstaaten verteilt. Von dem verbleibenden Restvermögen sollte ein Fonds zur direkten Entschädigung von Holocaust-Überlebenden eingerichtet werden, da bei den in Rede stehenden Vermögenswerten auch in beträchtlichem Maße Goldbestände von jüdischen Bürgern festgestellt wurden.
Konkrete Beschlüsse zum weiteren Vorgehen hatte die Londoner Konferenz aber nicht angestrebt. Vielmehr sollte eine Öffnung der Archive und eine ungehinderte Zugänglichkeit der Dokumente erreicht werden. Die Zu- und Abflüsse von Gold wurden sehr ausführlich dargelegt und offen diskutiert. Immer wieder spielten jedoch auch andere beschlagnahmte Vermögenswerte eine Rolle: Kontenguthaben, Firmen sowie Kunst- und Kulturgüter jüdischer Bürger. Die amerikanischen Vertreter boten schließlich an, zu einer Folgekonferenz einzuladen, die sich den entzogenen jüdischen Vermögenswerten in aller Breite widmen sollte.
Nur ein Jahr später, im Dezember 1998, wurde diese Ankündigung mit der Konferenz von Washington eingelöst. An ihr nahmen 57 Delegationen aus 44 Ländern, Vertreter von 13 NGO’s und zahlreiche Experten teil, insgesamt über 400 Personen. Die deutsche Seite war durch das Auswärtige Amt vertreten, und der damalige deutsche Botschafter in den USA, Tono Eitel, hielt die Abschlussrede, in der er die Position Deutschlands mit Blick auf den zukünftigen Umgang mit „looted art“ darlegte, nämlich für die Umsetzung der in Washington verabschiedeten Grundsätze Sorge zu tragen, nach Maßgabe der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten verstärkt nach entzogenem jüdischem Kulturgut zu suchen und anschließend gerechte und faire Lösungen zu finden.
Wie schon in London ein Jahr zuvor wurden auch in Washington die deutschen Entschädigungs- und Wiedergutmachungsleistungen als „einzigartige und präzedenzlose nationale Anstrengung“ hervorgehoben. Auch Ignatz Bubis, der in Washington als Präsident den „European Jewish Congress“ vertrat, würdigte diese deutschen Nachkriegsleistungen. Deutlich wurde aber auch, dass in der Zeit nach 1945 und in den langen Jahren der deutschen Teilung viele Betroffene ihre Ansprüche gar nicht entsprechend geltend machen konnten.
Die Vereinigung Deutschlands bot für diese offenen Fragen schließlich eine neue Chance der späten Wiedergutmachung, was noch in einem Vermögensgesetz der letzten DDR-Regierung Niederschlag fand, welches von der BRD im September 1990 in bundesdeutsches Recht übernommen worden ist. In der ehemaligen DDR waren bis dahin Leistungen in der Regel nur an systemkonforme Opfer des Faschismus gezahlt worden. Für Vermögenswerte, die man bis 1945 jüdischen Bürgern entzogen hatte, sah weder die sowjetische Besatzungsmacht noch die spätere DDR-Regierung Regelungsbedarf, vielmehr wurden diese Werte in Staatseigentum überführt.
Für die ihren jüdischen Eigentümern bis 1945 verfolgungsbedingt entzogenen Kunst- und Kulturgüter wurden am Ende der Konferenz die sog. elf Washingtoner Prinzipien verabschiedet. Sie basieren auf den Grundsätzen des amerikanischen Museumsverbundes AAMD und sollten nach dem Willen der Veranstalter als internationale Standards im Umgang mit NS-Raubkunst akzeptiert werden.
Eine Rechtsverbindlichkeit, also eine Umsetzung in das jeweils nationale Recht
einzelner Staaten, war damit jedoch nicht erreicht, sie gibt es bis heute nicht. Die unterschiedlichen Rechtssysteme der Teilnehmerstaaten standen dem ebenso entgegen wie die Auffassung, dass faire und gerechte Lösungen durch langwierige und kostenintensive Gerichtsverfahren nicht zu erreichen seien. In einem Kompromiss einigten sich die Teilnehmer dann darauf, die Prinzipien lediglich als Empfehlungen verstanden wissen zu wollen. Diese elf Washingtoner Grundsätze stellen jedoch bis heute die einzige internationale Übereinkunft zum Umgang mit NS-Raubkunst dar. Es gab vorher nur die nationalen Wiedergutmachungs- und Entschädigungsgesetze der unmittelbaren Nachkriegszeit, deren Fristen alle abgelaufen sind.
An erster Stelle der Prinzipien steht die Aufforderung zur Identifizierung beschlagnahmter Kunstwerke. Für diese umfangreiche Aufgabe sollten ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Forderung nach Provenienzermittlung ist eng verbunden mit dem Appell zur Öffnung der Archive und der Einrichtung eines Zentralregisters mit allen bekannten Kunstwerken, die von den Nazis geraubt wurden. Den Abschluss sollten faire und gerechte Lösungen zwischen den Vorkriegseigentümern oder deren Erben und den heutigen Besitzern bilden. Dabei wurde den besonderen Verfolgungsumständen der Betroffenen insofern Rechnung getragen, als man keine überzogenen Beweislasthürden formulierte. Es war nachvollziehbar, dass schriftliche Erwerbungsunterlagen aufgrund der Kriegsumstände möglicherweise nicht erhalten geblieben sind, weshalb auch andere Belege und Indizien ausreichen sollten, um die Berechtigung eines Anspruchs begründen zu können.
Die Auslegung und Umsetzung der Grundsätze
Das Kernstück der Prinzipien, nämlich bei Restitutionsbegehren „faire und gerechte Lösungen“ zu finden, hatte man in Washington nicht näher definiert. Die Beurteilung dieser Empfehlung als „soft law“ fiel deshalb sehr unterschiedlich aus und gelegentlich war von einem „stumpfen Schwert“ die Rede. Eine gewisse Verbindlichkeit der Washingtoner Prinzipien liegt jedoch darin, dass sie die einzige bis heute anerkannte Basis für Restitutionsentscheidungen im Zusammenhang mit NS-Raubkunst darstellen.
Aber auch noch in anderer Hinsicht hatten die Washingtoner Prinzipien entscheidende Bedeutung: Erstens erhielten Verfolgte und deren Erben auf der Grundlage dieser Grundsätze erstmals nach dem Fristablauf der Wiedergutmachungsvorschriften in Deutschland in den 1960er Jahren wieder entzogene Kunst- und Kulturgüter zurück. Und zweitens wurde die Provenienzforschung zur Aufklärung des nazionalsozialistischen Kulturraubs in Deutschland und weltweit wieder als aktuelle und vordringliche Aufgabe anerkannt, was auch konkrete Folgen hatte.
In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte die Umsetzung der Washingtoner Grundsätze durch die im Dezember 1999 verabschiedete „Gemeinsame Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“. Nach ersten praktischen Umsetzungsversuchen zeigte sich jedoch, wie hilflos und in den Wirkungen kontraproduktiv einzelne Einrichtungen teilweise mit diesen Grundsätzen hantierten, so dass im Februar 2001 die als „Handreichung“ bekannte Anleitung zur Prüfung und Behandlung von Restitutionsanfragen auf Initiative des damaligen Kulturstaatsministers von einer Expertenarbeitsgruppe formuliert wurde. Diese „Handreichung“ ist im November 2007 grundlegend überarbeitet worden, und zwar auf der Grundlage vielschichtiger Erfahrungen aus den fast 10 Jahren, die seit der Konferenz von Washington vergangen waren.
Zentrale Anliegen waren dabei erstens die effektive und friedensstiftende Gestaltung der Restitutionsverfahren, zweitens das Aufzeigen von Möglichkeiten für „gerechte und faire Lösungen“ im Sinne der Grundsätze von 1998 und drittens das Anbieten von Orientierungshilfen für die Provenienzrecherche an Museen, Bibliotheken und Archiven.
Entsprechend einer weiteren Verpflichtung aus der Washingtoner Erklärung wurde die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste in Magdeburg geschaffen, um identifizierte Kunstwerke in einem zentralen Register zu erfassen und zu veröffentlichen. Die Koordinierungsstelle ist – um dieser Aufgabe gerecht werden zu können – auf die Lieferung von Daten aus den Einrichtungen angewiesen, weil sie selbst keine Provenienzforschung betreibt. Die Meldung von Erkenntnissen aus der Provenienzrecherche einzelner deutscher Kultureinrichtungen beruht allerdings auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Die aus den Washingtoner Grundsätzen und der „Gemeinsamen Erklärung“ sich ergebenden Anforderungen an öffentliche Kunst- und Kultureinrichtungen in Deutschland lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die Sammlungen der öffentlichen Hand sollten sich erstens der Verantwortung bewusst sein, zur Auffindung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut in den eigenen Sammlungsbeständen beizutragen, sie sollten zweitens anhand der zugänglichen Dokumente und des aktuellen Forschungsstandes Werke mit ungeklärter Provenienz, die vermutlich NS-verfolgungsbedingt entzogen worden sind, dokumentieren und diese Erkenntnis drittens durch Meldung an die Koordinierungsstelle in Magdeburg öffentlich bekannt machen.
Von den in Magdeburg verwalteten über 110.000 Datensätzen bezieht sich allerdings der größte Teil auf kriegsbedingt verlorene Kunst- und Kulturobjekte, die ursprüngliche Hauptaufgabe der von Bund und den Ländern eingerichteten Stelle. Hinzu treten über 8.000 Fundmeldungen von deutschen Einrichtungen zu NS-Raubkunst.
Als weiterer Schritt zur Umsetzung der Washingtoner Grundsätze gilt die Einrichtung einer Beratenden Kommission, nach ihrer Vorsitzenden Jutta Limbach auch als „Limbach-Kommission“ bezeichnet. Das Gremium wurde in Abstimmung zwischen dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Kultusministerkonferenz der Länder und den kommunalen Spitzenverbänden gebildet. Zu ihren ehrenamtlichen Mitgliedern gehören u. a. Richard von Weizsäcker, Rita Süssmuth und Reinhard Rürup. Die Kommission hat die Aufgabe, bei Differenzen über die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, die sich heute in Museen, Bibliotheken, Archiven oder anderen öffentlichen Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland befinden, als Vermittler zwischen den Trägern der Sammlungen und den ehemaligen Eigentümern der Kulturgüter bzw. deren Erben zu agieren und entsprechende Empfehlungen auszusprechen, die allerdings rechtlich nicht bindend sein können, weil sie einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage entbehren. Diese Kommission kann angerufen werden, wenn dies von beiden Seiten gewünscht wird. Sie hat bislang drei Empfehlungen ausgesprochen. Die Akzeptanz des Gremiums ist hoch, doch wird es nur höchst selten angerufen. Sehr kontrovers debattiert man die Frage, ob auch eine einseitige Anrufung der Kommission in Betracht gezogen werden sollte. Vielleicht bringt diese Tagung hierzu weiterführende Aspekte.
Unter dem Eindruck verschiedener Restitutionsersuchen jüdischer Eigentümer oder deren Erben seit 1990 war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) schon im Sommer 1999, also noch vor der Veröffentlichung der „Gemeinsamen Erklärung“, zu einer eigenen Haltung in dieser Frage gelangt. Grundlage war ein Beschluss des Stiftungsrats der SPK vom 4. Juni 1999, der ganz im Geiste der Washingtoner Grundsätze und der später veröffentlichten „Gemeinsamen Erklärung“ formuliert wurde. Der Stiftungsrat begrüßte dabei die Bemühungen des Präsidenten, zur Aufklärung entsprechender Sachverhalte beizutragen und die Dokumentationen Dritten zugänglich zu machen. Ferner ermächtigte er den Präsidenten, einvernehmliche Lösungen zu suchen und akzeptiert hierbei auch die Herausgabe von Kunstwerken, selbst wenn dies nicht zwingende Folge einer gesetzlichen Regelung ist.
Die Stiftung befasste sich zuvor seit der Wiedervereinigung mit Restitutionsansprüchen auf der Grundlage des sog. Vermögensgesetzes. Die SPK hat mit dem 3. Oktober 1990 die seit Kriegsende und der Teilung Deutschlands im Gebiet der früheren DDR verwalteten Teile der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatsbibliothek zu Berlin und des Geheimen Staatsarchivs durch die Bestimmungen des Einigungsvertrages in ihre Trägerschaft übernommen. Damit wurden die seit 1961 geteilten Einrichtungen wieder vereinigt. Ansprüche nach dem in der alten Bundesrepublik geltenden Wiedergutmachungsrecht auf Kunstwerke in der Stiftung waren 1961 zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme der 1957 durch Bundesgesetz eingerichteten Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht mehr anhängig und wegen des Ablaufs der gesetzlichen Anmeldefristen auch nicht mehr möglich. Bis zur Wiedervereinigung 1990 sah sich die Stiftung – wie im Übrigen auch andere deutsche Museen, Bibliotheken und Archive – nicht mit solchen Restitutionsfragen konfrontiert.
Seit 1991 ergaben sich dann zunehmend Kontakte zwischen der SPK und der Jewish Claims Conference (JCC) über Kunstwerke, die vor Kriegsende in die heutigen Sammlungen der Einrichtungen der Stiftung gelangt waren. Die Stiftung veranlasste daraufhin eine erste Durchsicht aller Inventare der wiedervereinigten Berliner Museen. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Feststellung, ob bei den bekannten Erwerbungsumständen ein Zusammenhang mit verfolgungsbedingten Vermögensverlusten zu vermuten war. Die Durchsicht wurde auf solche Erwerbungen beschränkt, die zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 erfolgt waren und entweder auf einer amtlichen Zuweisung beruhten oder aufgrund von Inventarbucheinträgen als ehemals jüdisches Eigentum zu erkennen waren. Die dabei festgestellten Werke mit ungeklärter Provenienz wurden der Jewish Claims Conference bekannt gegeben. Das Vermögensgesetz beinhaltete jedoch eine Ausschlussfrist: Ansprüche konnten danach nur bis zum 30. Juni 1993 angemeldet werden. Die Stiftung erklärte jedoch schon damals gegenüber der Jewish Claims Conference, auch zukünftig diesen Fristablauf Rückgabeansprüchen nicht entgegen zu halten.
Ab 1998 erhielt die Stiftung dann zunehmend Anfragen nach Kunstwerken, die vor 1945 den Besitzer gewechselt hatten, und sich nach dem Krieg in West-Berlin befunden hatten. Meist waren es Hinterbliebene von verfolgten jüdischen Sammlern, die überwiegend durch Anwälte vertreten wurden.
Beispielhaft war der Fall der Zeichnung „Olivenbäume vor dem Alpillengebirge” von Vincent van Gogh aus der Sammlung Max Silberberg. Das Werk wurde 1935 auf einer Auktion durch den Verein der Freunde der Nationalgalerie erworben, von diesem unmittelbar nach dem Kauf als Geschenk an die Nationalgalerie weitergegeben, 1957 in der Nationalgalerie Berlin-Ost inventarisiert, und zwar mit der Herkunftsangabe „Geschenk des Vereins der Freunde der Nationalgalerie, Sammlung S., Schlesien“. Ein Rückgabeanspruch war durch die Jewish Claims Conference angemeldet worden, und nach Klärung der Provenienz erfolgte schließlich die Restitution an die Erbin, weil kein Zweifel an der Verfolgungsbedingtheit des Verlustes bestehen konnte.
Aus derselben Sammlung stammte das in der Nationalgalerie verwahrte Gemälde „Selbstbildnis mit gelbem Hut” von Hans von Marées, erworben 1935 auf derselben Auktion wie die van Gogh-Zeichnung. Das Werk war bei Kriegsende durch amerikanische Militärdienstsstellen beschlagnahmt worden und kehrte Anfang der 1960er Jahre an die Nationalgalerie nach West-Berlin zurück. Zweifel an der Herkunft und an der Verfolgungsbedingtheit des Verlustes bestanden aufgrund der Angaben der Erbin auch bei diesem Werk nicht. So schloss die Stiftung mit ihr einen Rückgabevertrag und konnte das Werk im Dezember 1999 von ihr erwerben und damit dauerhaft in der Nationalgalerie behalten.
Im Bibliotheksbereich der SPK sind es vor allem die aktiven Recherchen der Staatsbibliothek, die in den letzten Jahren immer wieder zu Restitutionen geführt haben. Zu nennen sind hier exemplarisch die Rückgabevereinbarungen mit den Erben von Arthur Rubinstein, Leo Baeck und Edwin Geist, die im Sinne von fairen und gerechten Lösungen die in Berlin aufgefundenen Einzelbestände zurückerhalten haben. Die Musikalien von Edwin Geist befinden sich inzwischen auf Grund eines Leihvertrages weiterhin in der Staatsbibliothek zu Berlin (heute Abend werden wir seine Musik im Abendprogramm genießen können). Das in der Staatsbibliothek laufende Projekt zur Aufklärung der Wirkungen der „Reichstauschstelle” fördert zahlreiche weitere Hinweise zutage, denen intensiv nachgegangen wird.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fühlt sich als Nachfolgerin des Trägers der Preußischen Staatlichen Museen und der Preußischen Staatsbibliothek, die im Laufe ihrer Entwicklung maßgeblich von jüdischen Mäzenen gefördert wurden, in besonderer Weise dazu verpflichtet, die einst empfangene Großzügigkeit zum Anlass für weitgreifende Entscheidungen im Umgang mit Restitutionsansprüchen zu nehmen. Angesichts der bekannten Rechtslage nach den Wiedergutmachungs- und Vermögensgesetzen berief sich die Stiftung auf die Freiheit zur freiwilligen Leistung unter besonderen Bedingungen.
Der im Sommer 1999 gefasste und bereits erwähnte Beschluss des Stiftungsrats räumt dem Präsidenten ausreichenden Handlungsspielraum für die Behandlung der Rückgabebegehren ein. Seither kann er auf dem Verhandlungswege mit den Erben und Berechtigten nach einvernehmlichen Lösungen suchen und selbständig entscheiden, ob Kunstwerke herauszugeben sind. Damit wurde der Weg für eine freiwillige Restitution geebnet, da in den meisten Fällen gesetzliche Fristen verstrichen und Ansprüche somit nicht mehr durchsetzbar waren. Kunstwerke, die vor dem 3. Oktober 1990 in den ehemaligen West-Einrichtungen der Stiftung aufbewahrt wurden, sind davon nicht ausgeklammert.
Die Stiftung ist durch diese Handlungsvollmacht in einer günstigeren Position als viele andere deutsche Museen, die in diesen Fragen weiterhin von ihren Trägern abhängig sind und für entsprechende Entscheidungen einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigen, ein Umstand, der für die oft sehr betagten Antragsteller nicht unerheblich ist. Unabhängig von den Vorgaben der Washingtoner Grundsätze musste die Stiftung in dieser Situation jedoch Voraussetzungen für den Umgang mit Rückgabeersuchen definieren, die inzwischen zu wichtigen Leitlinien für andere deutsche Einrichtungen geworden sind, die sich mit Restitutionsbegehren befassen; sie haben auch Eingang in die bereits erwähnte Handreichung gefunden.
Für eine freiwillige Restitution müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst einmal ist die Werkidentität des zurückgeforderten Stückes mit dem Objekt aus den Sammlungen der Stiftung eindeutig zu belegen, wobei der Identitätsnachweis grundsätzlich vom Anspruchssteller zu führen ist. In Zweifelsfällen geht die Unaufklärbarkeit dieser zentralen Voraussetzung zu Lasten der Anspruchssteller, da öffentliche Sammlungen stets zum Erhalt ihrer Bestände verpflichtet sind und nicht wie Privatpersonen beliebig über ihr Eigentum verfügen können. Die strikte Einhaltung dieses Kriteriums ist außerdem die Gewähr dafür, dass Fehlentscheidungen vermieden werden und Rückgaben tatsächlich an die Berechtigten erfolgen.
Ein zweites unverzichtbares Entscheidungsmittel ist der Nachweis des Vermögensverlustes in der NS-Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945. Die Anforderungen dafür lassen sich nicht abstrakt definieren, sie orientieren sich vielmehr stets am Einzelfall und ergeben sich häufig weniger aus noch vorhandenen Unterlagen als vielmehr aufgrund einer Kette von Indizien, die am Ende eine belastbare Einschätzung zulassen. In den bisher bei der Stiftung behandelten Fällen hat es in dieser Hinsicht keine Fälle gegeben, die zweifelhaft blieben.
Die Umstände einer Verfolgungsbedingtheit des Vermögensverlustes lassen sich ebenfalls nicht allgemeingültig festlegen. Hierfür gilt analog die sog. Verfolgungsvermutung nach den Wiedergutmachungsgesetzen und dem Vermögensgesetz. Zugunsten der Berechtigten wird die Verfolgungsbedingtheit des Vermögensverlustes vermutet, soweit dieser in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 eingetreten ist. Diese Verfolgungsvermutung ist als Grundsatz zu verstehen; Grenzfälle sind dann denkbar, wenn der Eigentümer rechtsgeschäftlich verfügt hat, einen marktüblichen Kaufpreis erzielt und diesen auch zu seiner freien Verfügung erhalten hat.
Kein entscheidungserheblicher Umstand war in den bisher bei der Stiftung behandelten Fällen die Tatsache, dass Sammler möglicherweise schon vor 1933 erfolglos versucht hatten, das Werk zu veräußern, aus welchen Gründen auch immer. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führte für viele Sammler zu einer ernsthaften Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Die Kunstsammlungen stellten häufig den einzigen kurzfristig zu Geld zu machenden Vermögenswert dar, und so sahen sich viele zum Angebot ihres Sammlungsbestandes gedrängt. Ausschlaggebend für die Restitutionsentscheidung der Stiftung werden deshalb immer die Veräußerungs- oder Verlustumstände nach 1933 sein.
Die Prüfung des Zeitpunkts und der Umstände des Besitzwechsels einerseits und des Erwerbs durch Museen, Bibliotheken und Archive andererseits birgt in der Praxis die meisten Schwierigkeiten. Relativ eindeutig sind jene Fälle, in denen der Erwerb unmittelbar auf Zwangsversteigerungen oder staatlichem Entzug von Kunstwerken beruhte, sofern es dafür heute noch eindeutige Belege gibt. Schwieriger wird es, wenn diverse Zwischenverkäufe stattgefunden haben und die Unmittelbarkeit zwischen dem Vermögensverlust auf der Opferseite und dem Erwerb des Museums auf der anderen Seite nicht mehr gegeben sind.
Nach bisheriger Auffassung der Stiftung wird die Unmittelbarkeit jedoch nicht dadurch gestört, wenn ein Zwischenerwerber, wie z. B. ein Freundesverein, das Werk gekauft und dann dem Museum geschenkt hat. Problematisch können allerdings solche Fälle sein, in denen vor dem Erwerb durch das Museum mehrere Zwischenerwerbe geschehen sind oder auch der zeitliche Zusammenhang mit dem Vermögensverlust nicht mehr besteht. Deshalb bleibt es nach unserer Auffassung absolut unverzichtbar, den Weg jedes einzelnen Kunstwerks vom Vermögensverlust bis zum Erwerb durch das Museum so lückenlos wie möglich nachvollziehbar zu machen. Diese Aufgabe kann und muss die Provenienzrecherche leisten. Wir wissen nur zu gut, welch massiver Forschungsbedarf hier besteht, der umfassend und transparent von deutschen Museen, Bibliotheken und Archiven in den nächsten Jahren zu leisten sein wird.
Nach 1998 wurde auch immer wieder erörtert, ob frühere Wiedergutmachungs- bzw. Entschädigungsverfahren aktuelle Restitutionsüberlegungen ausschließen. Für die Stiftung war in diesem Zusammenhang aber eher die Frage von Bedeutung, ob die Berechtigten aufgrund der Verfolgung überhaupt in der Lage waren, Fristen einzuhalten oder ihren Anspruch und den Vermögensverlust darzulegen und zu beweisen. War dies nicht der Fall, und sprachen die Umstände aber dennoch für eine Berechtigung der Antragstellung, wäre im Ergebnis jede andere Entscheidung als eine Restitution aus Sicht der SPK unerträglich gewesen.
Viele Wiedergutmachungs- bzw. Entschädigungsverfahren sind durch Geldzahlungen abgeschlossen worden sind, weil die Betroffenen in den 1950er Jahren keine Kenntnis vom Verbleib ihrer Kunstwerke, Bücher oder Archivalien hatten und auch keine Möglichkeit der Nachforschung gegeben war. Tauchen heute Werke auf, deren Provenienz nachweisbar ist, so kann eine erfolgte Ersatzzahlung, die in der Regel minimal war, unseres Erachtens kein Grund sein, eine Rückgabe abzulehnen. Lediglich das „Verbot der Doppelentschädigung“ ist hier zu beachten, wonach im Falle einer Restitution heute die früher erhaltende Geldleistung erstattet werden muss.
Provenienzforschung in Deutschland
Noch einmal: Provenienzrecherche bildet die Grundlage für eine Umsetzung der Washingtoner Grundsätze sowie für das Verhandeln über faire und gerechte Lösungen bei der Bearbeitung konkreter Einzelfälle. Sie ist dabei von derjenigen Kultureinrichtung zu leisten, in dessen Bestand sich das betreffende Werk befindet. Die oftmals geforderte sofortige und flächendeckende Provenienzforschung als Aufgabe der Sammlungen wird es aufgrund des nicht zu leistenden Aufwands kaum geben können. Hinzu kommt, dass die aktive Aufklärung der Sammlungsgeschichte einzelner Werke in Häusern mit hohen Bestandszahlen nur schrittweise und systematisch erfolgen kann.
Das Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin hat mit Blick auf die notwendige Provenienzforschung der stiftungseigenen Bestände ein Phasenkonzept entwickelt. Eine Grundlage der Provenienzrecherche bilden die vom Zentralarchiv veröffentlichten Findbücher der Aktenbestände der Nationalgalerie, der Skulpturensammlung und der Gemäldegalerie. Darüber hinaus wird eine sog. Tiefenerschließung für ausgewählte Aktenbestände der Nationalgalerie betrieben. Sie lässt vielfältige Rückschlüsse auf Werke, Eigentümer und Händler zu, da die Akten nicht nur auf Ankäufe, sondern auch auf Angebots- und Leihvorgänge durchgesehen werden. Dabei ergeben sich vielfältige Querverweise zu privaten und öffentlichen Sammlungen sowie zu früheren Besitzern, die nachvollziehbare Provenienzen entstehen lassen.
Für die systematische Erschließung aller Sammlungsinventare und Archivalien der Erwerbungen ab 1933 ist für die stiftungsinterne Provenienzforschung eine unbefristete Vollzeitstelle im Zentralarchiv eingerichtet worden, um die Herkunft der Werke – insbesondere aus ehemals jüdischem Kunstbesitz – zu klären, die sich heute im Bestand der Staatlichen Museen befinden. Vergleichbare Anstrengungen werden in Köln (Städtische Sammlungen), München (Bayerische Staatsgemäldesammlungen) und Hamburg (Kunsthalle/Museum für Kunst und Gewerbe) unternommen. Eine solche systematische Provenienzrecherche mit den eigenen Beständen wird in Deutschland sonst fast ausnahmslos nur von befristet angestellten Provenienzforschern betrieben, sofern sie überhaupt stattfindet.
Daneben gibt es Fragestellungen oder Bestandsgruppen, bei denen systematische Provenienzforschung auch ohne Bindung an einen Einzelfall erfolgen kann. Exemplarisch möchte ich hier die begonnene Prüfungen des Gesamtbestandes der sog. „Galerie des XX. Jahrhunderts“ der Nationalgalerie anführen, eine Sammlung, die überwiegend im Eigentum des Landes Berlin steht, aber seit Jahrzehnten quasi eigentumsgleich von der Stiftung gepflegt, verwahrt und ausgestellt wird. Nicht erst durch das aktuell in der Prüfung befindliche Werk von Lionel Feininger, „Kirche von Niedergrunstedt“, für welches die Provenienz derzeit von der Berlinischen Galerie bearbeitet wird, ist sowohl dem Land Berlin wie auch der Stiftung bewusst, dass diese Sammlung sehr gründlich zu untersuchen ist, weil sie eine Vielzahl von Werken enthält, die in dem kritischen Zeitraum vor 1945 entstanden sind. Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen, und wir haben das ehrgeizige Ziel, die Erschließung dieses Konvoluts bis spätestens Ende 2011 zu beenden. Die Ergebnisse werden wir dokumentieren und veröffentlichen, ganz so, wie es die Washingtoner Grundsätze vorsehen.
Die notwendige Aufklärung der Fakten ist aber häufig nur im Zusammenwirken der Betroffenen möglich, da nicht alle Erwerbungen in den Kultureinrichtungen erkennen lassen, dass es sich um verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter handeln könnte. Viele der zwischenzeitlich restituierten Werke der Stiftung waren öffentlich ausgestellt oder zumindest als Museumsbestand publiziert. Bei den wenigsten waren die Hinweise in den Inventaren so deutlich, dass eine Provenienzrecherche seitens der eigenen Häuser einzuleiten gewesen wäre.
Unter dem Eindruck der öffentlichen Debatten um die Restitution der „Berliner Strassenszene“ von Ernst Ludwig Kirchner hatte Kulturstaatsminister Bernd Neumann im November 2006 führende Museums- und Einrichtungsleiter, Kunst- und Rechtsexperten sowie Betroffene zu einem Gesprächs- und Erfahrungsaustausch eingeladen. Nach mehreren Treffen wurden wichtige Grundsatzfestlegungen getroffen. So waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass die Grundsätze der Washingtoner Erklärung von 1998 sowie die „Gemeinsame Erklärung“ von 1999 nicht Frage gestellt werden dürfen. Die „Handreichung“ wurde aktualisiert und praxisorientierter gestaltet, wobei man die bisherigen Erfahrungen berücksichtigte.
Ferner bestand Einigkeit darüber, dass die Provenienzforschung in deutschen Museen systematisch und umfassend erfolgen sollte und die Einrichtungen hierfür finanzielle und konzeptionelle Unterstützung erhalten müssten. Bis heute ist der tatsächliche Umfang der betroffenen Bestände in deutschen Kultureinrichtungen unbekannt; das muss sich ändern. Grund dafür ist nicht, dass die Museen und ihre Träger dem nicht nachkommen wollten. Vielmehr reichen die Kapazitäten des Stammpersonals in der Regel nicht aus, um diese Aufgabe neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen. Mitunter fehlt es auch an der erforderlichen Erfahrung oder Qualifikation für diese komplexe Tätigkeit der Provenienzrecherche. Umfassende Projekte, wie das der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in dem seit Frühjahr 2008 mit Unterstützung der Landesregierung über 10 Jahre hinweg und einem Budget von 15 Millionen Euro die 1,2 Millionen Bestände der SKD in einer Datenbank erfasst und nach ihrer Provenienz untersucht werden, sind eine höchst seltene Ausnahme, national wie international.
Mit geringeren Mitteln und doch stetig erforscht das Bundesfinanzministerium seit dem Jahre 2000 die Herkunft von immer noch 13.000 Kunstwerken, die sich in seiner Verwahrung befinden, nachdem es sie von den Westalliierten einst zu treuen Händen übergeben bekam. Über 50 Werke aus jüdischem Vorbesitz sind bereits ermittelt und jedes Werk, dessen unrechtmäßiger Besitz nachgewiesen werden kann, wird umgehend restituiert. Bisher war meist nur der Zeitraum zwischen 1933 und 1945 im Blickpunkt, dabei sind die Erwerbungen der Nachkriegszeit ähnlich problematisch und lassen weitere Restitutionsansprüche erwarten, sofern sich in den Jahren 1933 bis 1945 die Eigentumsverhältnisse geändert hatten.
In seiner Rede zum Bundeshaushalt 2008 hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann am 12. September 2007 im Deutschen Bundestag erklärt, dass die Verantwortung für unsere Vergangenheit auch den Bereich der Rückgabe der von den Nationalsozialisten geraubten oder beschlagnahmten Kulturgüter aus ehemals jüdischem Besitz betrifft. Er betonte, dass es seine wichtigste Aufgabe sei, verlässliche Regelungen zu finden, die sowohl den legitimen Interessen der Erben wie auch den Sorgen der Museen Rechnung trügen. Da Museen, Bibliotheken und Archive mit der aufwendigen Provenienzrecherche nicht allein gelassen werden könnten, wurden ab 2008 über drei Jahre verteilt rund 5 Mio. Euro für eine Arbeitsstelle für Provenienzforschung bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bereitgestellt. An diese Initiative knüpfte sich die Erwartung, dass sie beispielgebend für Länder und Kommunen sein möge, in deren Verantwortung sich die größte Zahl der Museen befände.
Die Kulturstiftung der Länder unterstützt diese Arbeitsstelle für den gleichen Zeitraum mit weiteren 200.000 Euro jährlich aus Ländermitteln. Sie sind für die Unterhaltung und die Personalkosten der Arbeitsstelle vorgesehen. Diese hat die Aufgabe, öffentliche Museen, Bibliotheken und Archive in Deutschland bei der Identifizierung von Kulturgütern in ihren Sammlungen und Beständen zu unterstützen, die während der Zeit des Nationalsozialismus den rechtmäßigen Eigentümern entzogen worden sein könnten. Finanziell gefördert werden sowohl einzelfallbezogene Rechercheprojekte als auch die systematische Erforschung von Sammlungskonvoluten oder Gesamtbeständen. Das Vergabeverfahren ist so übersichtlich und transparent wie möglich gestaltet, um keine zusätzlichen verwaltungstechnischen Hürden aufzubauen, sondern die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt, wirkungsvoll und rasch zum Einsatz zu bringen.
Neben der Projektförderung hat es sich die Arbeitsstelle zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Institutionalisierung der Provenienzforschung und zur Verstetigung der Ergebnisse zu leisten. Entscheidend wird es sein, solche Untersuchungen stärker zu vernetzen, die sich mit der Geschichte öffentlicher wie privater Sammlungen und Bibliotheken, des Kunst- und Antiquitätenhandels und des Auktionswesens während der Zeit des Nationalsozialismus sowie mit der Struktur und Funktionsweise des nationalsozialistischen Vollzugs- und Verwertungsapparates im Hinblick auf jüdisches Eigentum befassen. Ferner will die Arbeitsstelle die Ergebnisse der Provenienzüberprüfung einzelner Objekte mit der historischen Kontextforschung koppeln und die gewonnenen Erkenntnisse der Fachöffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es ist zu erwarten, dass sich aus den Projekten neue und weiterführende Fragestellungen ergeben. Mit einem elektronischen Archiv, das eine Datenbank und ein Kommunikationsforum einschließt und von der Arbeitsstelle redaktionell betreut wird, soll ein wichtiges und alsbald unverzichtbares Arbeitsmittel für die Provenienzforschung bereitgestellt werden. Die Arbeitsstelle wurde im Juni 2008 eingerichtet, ihr Leiter, Uwe Hartmann, wird im Verlaufe der Tagung ebenfalls noch zu Wort kommen.
Insgesamt lässt sich bilanzieren, dass 10 Jahre nach der Washingtoner Konferenz in Deutschland viele Restitutionsentscheidungen getroffen und die Grundlagen für eine systematische Aufarbeitung der in Rede stehenden Bestände in deutschen Einrichtungen geschaffen worden sind, auch wenn der Weg noch lang ist, und die Provenienzforschung erst am Anfang einer gewaltigen Aufgabe steht.
Themenblöcke der Tagung
Die Tagung heute und morgen widmet sich drei verschiedenen Themenblöcken. Der erste befasst sich mit Grundfragen der Restitution und wird aufzeigen, dass die Restitution auf Grund der Washingtoner Prinzipien und der daraus resultierenden gemeinsamen Handreichung nicht ohne Vorläufer war. Zu nennen sind hier für das Gebiet der „alten“ Bundesrepublik das Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung von 1956 und das Bundesrückerstattungsgesetz von 1957 sowie nach der deutschen Vereinigung das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen von 1990 für das Beitrittsgebiet. Dabei wollen wir auch die deutschen Regelungen zur Umsetzung der Washingtoner Grundsätze mit der Situation in anderen Ländern vergleichen, um den Bedarf und die Möglichkeiten von rechtlichen Nachbesserungen sowohl in Deutschland wie auch in anderen Staaten herauszuarbeiten.
Unabhängig davon, wie die Restitution rechtlich ausgestaltet wird, ist die Provenienzforschung die notwendige Grundlage, ihr geben wir deshalb auf dieser Tagung breiten Raum. Dabei wird bisweilen zwischen sog. freier Provenienzforschung, also selbstständigen, im Auftrag von Antragsstellern oder Anwälten forschenden Kunsthistorikern, und der Provenienzforschung durch Mitarbeiter von Kultureinrichtungen unterschieden. Eine solche Trennung ist aber unseres Erachtens nicht maßgeblich. Freie und angestellte Provenienzforscher unterscheiden sich ausschließlich in den Rahmenbedingen ihrer Arbeitsverhältnisse zum Auftraggeber, nicht aber in der methodischen Herangehensweise und in den Problemen der lückenhaften Quellenlage.
Die Debatten um faire und gerechte Lösungen sind ein Kernthema, das insbesondere bei Einzelfällen, wie z. B. der Kirchner-Entscheidung, immer wieder aufgegriffen wird. Georg Heuberger von der Jewish Claims Conference hat wiederholt darauf hingewiesen, dass es faire und gerechte Lösungen nur geben kann, wenn auch die Verfahren fair und gerecht verlaufen, weil nur so die Antragsteller das Ergebnis, wie auch immer dieses aussehen mag, für sich akzeptieren können. Doch wie muss ein solches Verfahren aussehen? Und ist ferner nur die Rückgabe eines Kunstwerkes eine „faire und gerechte Lösung“, oder gibt es auch andere Möglichkeiten, und welche Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein?
Aggressiv vorgetragene Restitutionsbegehren sind ebenso wie sture Blockadehaltungen einzelner Museen wenig geeignet, zu gerechten und fairen Lösungen zu gelangen. Viele Museen reagieren in aller Regel erst dann, wenn Anwälte konkrete Forderungen an sie stellen. Das führt meist dazu, dass die Bilder verkauft werden müssen, um die Anwälte zu bezahlen. Könnten die Museen von sich aus mehr Personal und Geld in die Provenienzforschung investieren, ließen sich sachgerechtere Lösungswege finden.
Die bisher von der „Beratenden Kommission“ bearbeiteten Fälle lassen eine gewisse Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten erkennen. So empfahl die Kommission im Fall der Eheleute Julius und Clara Freund die Rückgabe dreier Gemälde von Karl Blechen und eines Aquarells von Anselm Feuerbach. Das Ehepaar Freund musste – aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen mittellos – 1939 nach London emigrieren. Nach dem Tod ihres Mannes sah sich Clara Freund 1942 aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Werke in der Schweiz zu verkaufen.
Hinsichtlich der Plakatsammleung von Hans Sachs sprach sich die Kommission dagegen dafür aus, diese im Deutschen Historischen Museum zu belassen. Dem Museum wurde aber aufgetragen, die Herkunft der Sammlung und das Wirken von Sachs in angemessener Weise öffentlich zu machen und zu würdigen. Nach umfangreicher Befassung mit Äußerungen des Sammlers selbst war die Kommission zu der Überzeugung gelangt, diese Lösung entspreche am besten der Intention des Sammlers.
Im Falle des Erben von Laura Baumann riet die Kommission im Hinblick darauf, dass der Antragsteller nur zur Hälfte Miterbe wurde, möglicherweise durch das Museum bereits eine Zahlung erhalten hatte und der Sachverhalt nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden konnte, das Gemälde im Museum zu belassen und dem Antragsteller eine Entschädigung von 10.000 Euro zu bezahlen; der Schätzwert des Werkes lag bei 30.000 bis 40.000 Euro. Gleichzeitig wurde die Museumslandschaft Kassel aufgefordert, bei seiner Präsentation auf die Provenienz des Gemäldes und die Entschädigungszahlung an den Antragsteller hinzuweisen.
Aus all diesen Beispielen wird deutlich, wie wichtig die Gegebenheiten jedes Einzelfalles sind, wenn eine wirklich faire und gerechte Lösung gefunden werden soll. Es erscheint uns aber in höchstem Maße hilfreich, im Rahmen dieses Symposiums noch einmal zu beleuchten, welche allgemeinen Erwartungen, Positionen und Lösungsansätze es hierbei gibt.
Ansätze für die weitere Diskussion
Zum Abschluss möchte ich noch auf einige weitere Fragen hinweisen, die bei der Befassung mit dem Thema Restitution immer wieder auftreten.
Die Freiwilligkeit von Vermögensverfügungen
Im Zusammenhang mit den bekannten Restitutionsfällen ist häufig zu vernehmen, dass bei den getroffenen Vermögensverfügungen der jüdischen Eigentümer über Kunst- und Kulturgüter die Verfolgungsbedingtheit in Frage gestellt wird. Es wird vermutet, dass die Verkäufe auf wirtschaftlichen Notsituationen der Sammler beruhten, mit der Weltwirtschaftskrise 1929 in Zusammenhang standen oder einfach als unternehmerische Fehlentscheidungen einzuordnen wären. Damit wird suggeriert, dass die damaligen Eigentümer freiwillig über ihre Kunstwerke verfügt hätten, um wirtschaftliche Notlagen auszugleichen, die nicht mit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in Verbindung zu bringen wären. Die für diesen Ansatz erforderliche Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und verfolgungsbedingten Zwangslagen scheint jedoch nicht immer mit der notwendigen Sorgfalt aufgearbeitet. In der Tat mag es solche Einzelfälle geben, in denen beide Gründe gleichermaßen Anlass für die Verkäufe waren. Doch was wäre die Konsequenz für einen Restitutionsanspruch? Sollte die Beweislast für solche Veräußerungen dann doch den Erben zufallen und anders als in den Rückerstattungsverfahren die Vermutungswirkung des verfolgungsbedingten Verlustes hier nicht greifen?
Der Wohlstand der Betroffenen
Auch der angebliche materielle Wohlstand jüdischer Bürger wird häufig als Argument für die Ablehnung einer Restitution angeführt. Dahinter verbergen sich oft unerträglich scheinheilige Argumente wie ein Auszug aus einem deutschen Wochenmagazin zeigt, der auf die Kirchner-Debatte einging, aber auch die Restitution der Klimt-Gemälde zum Inhalt hatte, überschrieben mit dem Titel „Im Strudel des Spekulationswahns“. Darin hieß es: „Altmann, eine elegante ältere jüdische New Yorkerin, die noch immer nahtlos in einen astreinen Wiener Dialekt verfallen kann, war verständlicherweise von dem ertragreichen Abend [der Versteigerung bei Sothebys in N.Y.] überaus beglückt. Die Lippenbekenntnisse der alten Dame vor der Versteigerung, die Kunst solle weiter der Öffentlichkeit zugänglich bleiben, waren unterdessen nicht sonderlich überzeugend. Zu den Versuchen der österreichischen Regierung, die Gemälde zu halten, sagte sie mitleidig: Ich verteile keine Spenden“.
Was will uns eine derartige Berichterstattung suggerieren? Sie ignoriert völlig die Tatsache, dass die alte Dame über acht Jahre mit dem österreichischen Staat ringen musste, um die Werke zurück zu erhalten, die ihrem Onkel verfolgungsbedingt entzogen worden waren. Kann man dann tatsächlich noch Wohlwollen erwarten? Darüber hinaus zeugt es von einem eigenartigen Rechtsverständnis, wenn man tatsächlich meint, der Wohlstand der Erben könnte bei einer Restitutionsentscheidung auch nur im Geringsten eine Rolle spielen.
Die Zeitschnittdebatte
„Es muss mal Schluss sein“; dieses Argument ist in der teils emotional, teils polemisch geführten Debatte um die Grundsätze der Restitution ebenfalls immer wieder zu vernehmen. Das Argument von der fehlenden Rechtssicherheit scheint dabei jedoch wenig überzeugend, insbesondere dann, wenn nicht gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. In diesem Zusammenhang ist das in den Niederlanden praktizierte Modell bemerkenswert. Die zweifelsfrei als jüdisches Alteigentum identifizierten Kulturgüter sind dort in einer Liste mit den notwendigen Werkangaben zusammengefasst und über das Internet publiziert worden. Damit besteht weltweit die Möglichkeit der Recherche für Erben und Rechtsnachfolger, die auf der Suche nach Kunstwerken sind, die ihre Angehörigen NS-verfolgungsbedingt zwischen 1933 und 1945 verloren hatten.
Mit der Veröffentlichung dieser Liste hat die Niederländische Regierung jedoch eine Fristsetzung verbunden. Danach können Anspruchsberechtigte ihre Forderungen innerhalb von drei Jahren nach Bekanntgabe der Werkliste geltend machen. Nach Ablauf der Frist gelten die Werke als rechtmäßiges Eigentum der Besitzer, wenn keine Forderungen angemeldet worden sind. Damit wird nach der notwendigen Feststellung der Provenienzen der Werke und einer angemessenen Frist eine für alle Seiten sinnvolle Rechtssicherheit erreicht, die auch im Licht der Verfolgung jüdischer Bürger durch die Nationalsozialisten vertretbar erscheint. Wir werden dazu sicher im Verlauf der Tagung noch Genaueres hören.
Schlussbemerkung
Aufgrund des rechtlich unverbindlichen Charakters der in Deutschland geltenden Grundsätze sind gerichtliche Verfahren zur Klärung von Einzelfällen kaum vorstellbar. Im außergerichtlichen Bereich kann es dagegen vielfältige Klärungs- und Entscheidungsmöglichkeiten geben. Sinnvoll wäre eine für die zu regelnden Fragen eingesetzte Mediation, ein beiden Seiten gerecht werdendes Verfahren mit einer Win-Win-Lösung am Ende, im Bedarfsfall durch einen neutralen Moderator. Denkbar sind als Ergebnis neben der Restitution durch Rückgabe des Werkes ebenso eine finanzielle Entschädigung in Geld oder eine Leihvereinbarung, verbunden mit der ausdrücklichen Feststellung, wer als Eigentümer des Werkes gilt, ggf. verknüpft mit einem wie auch immer ausgestalteten Vorkaufsrecht für das besitzende Haus, unabhängig davon, ob es sich um Museen, Bibliotheken oder Archive handelt. Nach den Erfahrungen der SPK kann dies hilfreich sein, um restitutionswilligen Kultureinrichtungen den nötigen zeitlichen Spielraum zu geben, die erforderlichen Erwerbungsmittel zu besorgen.
Nach dem unsäglichen vom Nationalsozialismus verursachten Unrecht an jüdischen Mitbürgern muss es bei der Restitution von verfolgungsbedingt entzogenen Kunst- und Kulturgütern in erster Linie um „faire und gerechte Lösungen“ gehen, wie sie die Washingtoner Grundsätze einfordern. Das Problem dabei ist, dass sich nicht allgemeingültig und juristisch einwandfrei definieren lässt, wie „faire und gerechte Lösungen“ auszusehen haben. Tatsache ist, dass jeder Einzelfall für sich zu betrachten ist. Und da Handreichungen allenfalls empfehlenden Charakter haben und nicht rechtlich verbindlich sein können, kommt es auf den Geist an, in dem Restitutionsansprüche, wenn sie berechtigt sind, verhandelt werden. Natürlich ist das Bestreben der Museen, die Kunst- und Kulturgüter der Öffentlichkeit zu erhalten, verständlich. Die Praxis in der SPK zeigt auch, dass dieses Ziel durchaus erreicht werden kann, wenn es gelingt, den Erben oder ihren Rechtsnachfolgern dieses überzeugend deutlich zu machen.