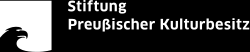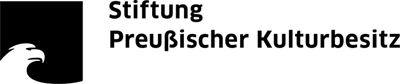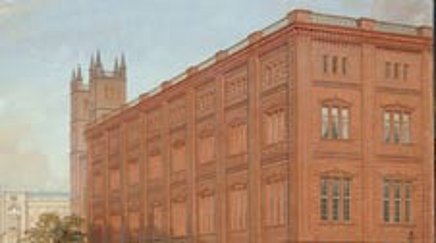Ein Haus voller Schätze
19.06.2018Ein Haus voller Schätze
Bücher und noch viel mehr: Die Generalsanierung der Staatsbibliothek Unter den Linden ist 2020 abgeschlossen und verspricht viel Freude wie Freiheit.

Zurück im „Stammhaus“ Unter den Linden
15 Jahre dauerte die Sanierung der Staatsbibliothek Unter den Linden, die 2020 abgeschlossen sein wird. Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf und Jens Andreae, seit 2010 verantwortlicher Projektleiter beim BBR, erzählen im Video von den Herausforderungen einer Sanierung im denkmalgeschützten Bestand und den innigen Beziehungen zum Gebäude.
-
Transkript ein- / ausblenden
Transkript
Jens Andreae: Das Bauen im denkmalgeschützten Bestand verfügt natürlich immer über den Reiz des Unerwarteten. Keine Voruntersuchung, die wir hier machen konnten, wäre auch nur ansatzweise ausreichend gewesen, um das Ausmaß der tatsächlich nötigen Arbeiten vorhersagen. Insofern haben wir jeden Tag mit neuen Herausforderungen zu rechnen und umzugehen. Was wir gerne tun im Interesse eines, am Ende stimmigen Erscheinungsbildes des Hauses.
Barbara Schneider-Kempff: Die Instandsetzung dieses Gebäudes, unseres „Stammhauses“, bedeutet für uns, dass wir es wiedergewonnen haben. Dass wir wieder hier so arbeiten können, auf verschiedenen Ebenen, durchaus auch – Wir sind gerade in den Veranstaltungsräumen – der Öffentlichkeit viel zeigen können, wie es mal vor mehr als 100 Jahren war. Und ich habe bei diesem Gebäude, ehrlich gesagt mehr als bei dem Scharoun-Bau in der Potsdamer Straße, immer gespürt, dass die Mitarbeiter, die hier arbeiten, doch eine ganz enge Beziehung dazu haben: dieses Haus besonders lieben. Insofern meine ich, ist es eine große Freude für uns, hier wieder sein zu können. Wir waren ja nie ausgezogen, wir haben ja, das ist ganz wichtig zu wissen, gebaut bei laufendem Betrieb. Aber natürlich häufig unter provisorischen Umständen. Und das ist jetzt anders.
© Video: SPK / Friederike Schmidt / Fotos: Max Zerrahn / Cover: Plateau Design Studio
Hat er oder hat er nicht? Hat Ludwig van Beethoven die berühmte „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller geändert und statt „Freude“ die Sänger und den Chor „Freiheit, schöner Götterfunken“ singen lassen? So, wie es Leonard Bernstein dirigierte am ersten Weihnachtstag 1989 im Ostteil Berlins im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, übertragen vom Fernsehen für Millionen von Zuhörern in aller Welt?
Inzwischen weiß man, dass es nicht Beethoven war, sondern dass Bernstein im Überschwang der Gefühle und euphorisiert vom Fall der Mauer den Text der Gunst der Stunde angepasst hat. Man kann das auch klipp und klar nachprüfen, gar nicht weit von der Spielstätte des Konzerts entfernt. Denn in der Staatsbibliothek Unter den Linden liegt wohlverwahrt und bestens behütet das Autograf der Neunten Symphonie, und wem der Weg zu lang ist, der kann sich die digitalisierte Version im Internet anschauen.


Als dieses knifflige Problem im wahrsten Sinn des Wortes behoben war, entstand an Stelle der Büchersilos der neue Lesesaal. Anders als sein Vorgänger, der mit mystischer Beleuchtung, einer gewaltigen Kuppel und hohen Wänden an einen Dom erinnerte, erstand er nach dem Entwurf des Architekturbüros HG Merz als 35 Meter hohe, lichtdurchflutete, anmutig gestufte Festhalle des Wissens mit rund 300 Arbeitsplätzen. Die von den Architekten vertretenen Richtlinien – Transparenz, Rhythmisierung und kompositorische Identität – wurden bei der Generalsanierung nach den strengen Auflagen des Denkmalschutzes konsequent überall umgesetzt.

Das hatte seinen Preis, der sich nach Abschluss der Baumaßnahmen auf rund 470 Millionen Euro belaufen wird – nach knapp 14 Jahren Bauzeit in einem Gebäude, das größer ist als der Reichstag oder das Humboldt Forum, für das es weit mehr als 14 000 Ausführungs- und Detailpläne der Architekten gab und für das 405 Bauaufträge, 115 Honorarverträge sowie 181 Aufträge an Fachtechnikfirmen vergeben wurden. „So etwas macht man nur einmal im Leben“, sagt Jens Andreae, der die Zahlen und Fakten auswendig parat hat.
Dann ist da noch der wilde Wein aus den 20er-Jahren im Ehrenhof des Geländes, der viel gesehen und miterlebt hat und inzwischen als Gartendenkmal eingestuft ist. Er wurde vorsichtig vom Mauerwerk abgelöst und mit Lederbändern an den Gerüsten befestigt, wo er einen Zwischenhalt finden sollte – und fand. Nun kann er sich, wie gehabt, am schlesischen Sandstein festsaugen und weiter wachsen.

Die Staatsbibliothek war eines der Lieblingsprojekte von Kaiser Wilhelm II., der mit diesem Prunkbau die Stellung der deutschen Wissenschaft in der Welt gewürdigt wissen wollte. Deshalb wurde sie in exquisiter Lage zwischen dem Brandenburger Tor und dem Schloss der Hohenzollern errichtet. Selbst der russischen Kommandantur war sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Angelegenheit von hoher Priorität und so wurde angeordnet, sie so schnell wie möglich zu eröffnen. Das geschah bereits im Sommer 1946, nachdem die enormen Kriegsschäden natürlich nur notdürftig behoben worden waren. Auch nach der Wiedervereinigung widmete man sich rasch der Staatsbibliothek und begann 1990 mit ersten Sicherungs- und Schutzmaßnahmen. Später wurden ungeahnte Schäden entdeckt, wovon als besonders gravierend die Risse in den Stahlfachwerkträgern über der Haupttreppenhalle und die rund 2700 faulenden Eichenpfähle im Fundament genannt sein sollen, die durch Betonpfähle ersetzt werden mussten.