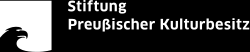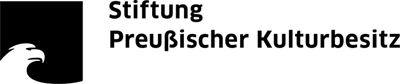Interpretationsforschung am Staatlichen Institut für Musikforschung: Interdisziplinarität als Programm
News vom 07.09.2020
Forschung, Vermittlung und Veranstaltungsaktivitäten des Staatlichen Instituts für Musikforschung sind auf Musik in ihrer klingenden Realisationsform ausgerichtet.

Die Interpretation von Musik bildet einen Schwerpunkt der Arbeit des Staatlichen Instituts für Musikforschung. Dazu tragen alle Fachabteilungen bei, die Instrumentenkundler des Musikinstrumenten-Museums, die Historiker der Abteilung Musiktheorie und Musikgeschichte, die Systematiker der Abteilung Akustik und Musiktechnologie. In deren »Virtuellem Konzertsaal« wurde unter anderem die audiovisuelle Wahrnehmung von Konzerträumen erforscht, also nach den Einflüssen gefragt, die der akustische und der optische Aufführungsraum auf die ästhetische Beurteilung haben. Historiker und Systematiker arbeiten aktuell an einem von der Staatsministerin für Kultur und Medien geförderten Projekt zur Digitalisierung und Erschließung historischer Aufnahmen mit Instrumenten aus der Sammlung des Museums. Und die Abteilung Musiktheorie und Musikgeschichte ist federführend bei einem mehrbändigen Werk zum Thema, der »Geschichte der musikalischen Interpretation im 19. und 20. Jahrhundert«.
Die Beschäftigung mit Fragen der Aufführung hat in der Musikwissenschaft seit bald einem Vierteljahrhundert Hochkonjunktur. Nachdem man sich über 100 Jahre vornehmlich mit Kompositionen und Komponisten beschäftigt hatte, entdeckte man in den 1970er Jahren zuerst den Rezipienten, in den 1990er Jahren dann auch den Interpreten. Zugleich boomte im Konzertleben die historisch informierte Aufführungspraxis, die sich seit den 1980er Jahren nach der Musik des Barockzeitalters zunehmend auch der Musik der Klassik, Romantik und des frühen 20. Jahrhunderts annahm, wobei sie einer Fülle von Musik zu neuem Leben verhalf, die man mehr oder weniger schon abgeschrieben hatte. Auch dadurch wurde deutlich, dass der Aufführung von Musik in Geschichte und Gegenwart eine weit größere Bedeutung zukommt, als es die ältere Musikwissenschaft geglaubt hatte und als ihr wissenschaftspraktisch wünschenswert schien. Das flüchtige Medium der musikalischen Interpretation, das zudem nur in Wechselwirkung mit Kompositionen, die interpretiert werden, zu denken ist, setzt einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht geringe Schwierigkeiten entgegen.
Dass ein so umfangreicher Gegenstand, der musikwissenschaftliche wie musikpraktische Kenntnisse voraussetzt, der ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden bedarf – Methoden der historischen und der systematischen Musikwissenschaft, der Geschichts- und der Sozialwissenschaften, hermeneutischer Verfahren wie dem Einsatz von Computertechnologie –, dass ein solcher Gegenstand angemessen kaum mehr von einem Wissenschaftler allein behandelt werden kann, ist leicht einzusehen. Am Projekt der »Geschichte der musikalischen Interpretation im 19. und 20. Jahrhundert« sind denn auch über 40 Forscher*innen beteiligt. Das Staatliche Institut für Musikforschung hat das Projekt über lange Jahre in regem Austausch mit der Fachgemeinde und dem Wissenschaftlichen Beirat des Instituts konzipiert und weiterentwickelt, jetzt sorgt es für seine Verwirklichung.
Der vorliegende erste Band entfaltet die zentralen ästhetischen Ideen, die mit der musikalischen Interpretation einhergehen, im zweiten geht es um Institutionen und Medien, die für die Geschichte der musikalischen Interpretation im 19. und 20. Jahrhundert von Bedeutung sind. Die Druckvorlage befindet sich seit vier Monaten beim Bärenreiter-Verlag, wo sich Corona-bedingt die Mitarbeiter in Kurzarbeit befinden. Keine Konzerte bedeuten keine Einnahmen aus Tantiemen, das Geschäftsmodell Musikverlag, selbst wenn es sich um ein so renommiertes Haus wie den Bärenreiter-Verlag handelt, gerät offenbar ins Wanken. Was dies für das SIM-Projekt bedeutet kann, ist noch offen. Unabhängig davon ist aber klar, dass Forschung zu klingender Musik sinnvoll nur multidisziplinär möglich ist, wie es am Staatlichen Institut für Musikforschung geschieht.