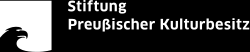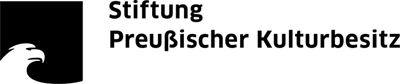„Schon spannend, was man hier so finden kann“
News vom 15.12.2017
Seit August 2017 ist Ulrike Höroldt die Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz (GStA). Wie ihre ersten 100 Tagen im Amt waren, durch welche Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sie das „Gedächtnis Preußens“ führen will und was ihr „Zauber des Anfangs“ ist, erzählt Ulrike Höroldt im Interview.

Frau Höroldt, in unserem letzten Gespräch vor Ihrem Amtsantritt antworteten Sie auf die Frage, wo Sie das GStA in fünf Jahren sehen und was Sie gern verändern würden, dass Sie erst die Innenperspektive brauchen. Was ist Ihre Antwort nach rund 100 Tagen im Amt?
Ich würde mich da jetzt nicht auf fünf Jahre festlegen, sondern generell drei Themenblöcke definieren, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen und die ich als Ziel für meine Amtszeit hier sehe. Zunächst müssen wir dringend dafür sorgen, dass die Archivalien des GStA eine angemessene, also archivgerechte Unterbringung finden. Im Moment haben wir das Problem, nur ein Drittel des Bestandes am Standort zu haben. Dieses Drittel ist in dem Altmagazin verwahrt, das auch nicht mehr dem heutigen archivischen Standard entspricht, weil es mehrere Jahrzehnte nicht saniert worden ist. Wir haben zwei Drittel unserer Bestände im Westhafen, das sind jene Teile, die aus Merseburg nach 1990 zurückgekommen sind. Dort lagern sie nicht optimal und sind vor allen Dingen durch die vielen Transporte zwecks Benutzung – Westhafen-Dahlem und zurück – sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Ich würde gern hier auf dem Gelände eine archivgerechte Unterbringung für die Archivalien erreichen. Das ist kompliziert, weil unser ursprüngliches Magazin zurzeit ja vom Museum für Europäische Kulturen (MEK) benutzt wird. Es muss also erst eine Konzeption gefunden werden, wie das MEK aus diesem Flügel herauskommen kann und danach wird man dort baulich erheblich anfassen müssen, um eine wirklich moderne, DIN-gerechte, archivfachliche Unterbringung zu gewährleisten.
Das zweite Thema ist die digitale Transformation, in der wir uns ja alle befinden. Wir müssen verstärkt und noch mehr als bisher daran arbeiten, unsere Bestände so zu erschließen, dass sie im Internet präsentiert werden können. Dazu müssen zwei Schritte gemacht werden: Zum einen muss die Erschließung selber erheblich verbessert werden, weil das, was bei einer Papiererschließung in bestimmten Dingen noch funktioniert hat, nicht unbedingt ohne weiteres für alle Bestände ins Internet übertragen werden kann. Wir haben beispielsweise einerseits Bestände, die gut in analogen Findbüchern erschlossen sind und die man relativ problemlos retro-konvertieren, also in die digitalen Systeme eingeben und dann im Internet präsentieren kann. Wir haben aber andererseits auch noch Bestände, die mit alten Registranten genutzt werden und die können wir eben nicht ohne Weiteres ins Internet hineintransformieren. An dieser Stelle ist noch erhebliche Facharbeit zu leisten, um unseren Nutzer möglichst viel auch über das Internet und damit ortsunabhängig zugänglich zu machen. So können sie vor einem Besuch von außen recherchieren kann: Was findet man im GStA? Und danach zur Benutzung kommen, um die Bestände einzusehen. Darüber hinaus werden wir aber auch versuchen, Digitalisate von Archivgut verstärkt im Internet zu präsentieren. Das wird aber immer nur ein Bruchteil dessen sein, was wir haben. Diesen Weg hat mein Amtsvorgänger bereits sehr gut und konstruktiv begonnen. Wir müssen ihn jetzt weiterführen und intensivieren, um den heutigen Ansprüchen zu genügen.
Der dritte Bereich betrifft die wissenschaftlichen Kooperationen, also die Erfüllung des wissenschaftlichen Auftrages, den wir als Archiv in Form eines Auswertungsauftrages ja haben. Wir müssen schauen, wie man vor allem durch Kooperationen mit Wissenschaftsorganisationen, DFG-Anträgen und ähnlichem unsere Archivalien für die Forschung noch besser fruchtbar machen kann. Dabei würde ich stärker als bisher differenzieren, was in Printform erscheint, oder was man verstärkt über das Internet als digitaler Edition beispielsweise präsentieren kann.
Das sind so die drei großen Zweige. Natürlich ist das alles in fünf Jahren nicht erreicht, sondern ist eher ein Weg, den man anfängt zu beschreiten und der so schnell nicht endet, auf dem man aber ein Stück vorankommt.
Sie sprachen von Kooperationen. Gibt es schon Pläne für Kooperationen, eventuell stiftungsweit?
Das wird sicherlich ein Thema sein, das die Stiftung insgesamt in den Blick nehmen muss: inwieweit es möglich ist, Bestände, die in verschiedenen Stiftungseinrichtungen liegen, auch gemeinsam zu bearbeiten und zu präsentieren. Da gibt es erste Überlegungen inhaltlicher Art, die aber erstmal weiterentwickelt werden müssen, bevor es spruchreife Ergebnisse gibt. Momentan ist es eher so, dass die Kooperationsfrage punktuell für bestimmte Themen gestellt wird. Gut wäre, zu überlegen, ob und wie man diese stiftungsweite Zusammenarbeit strategisch betrachtet und plant.
Pflegen Sie eigentlich weiterhin die Regel, dass alle E-Mails an das GStA über einen Eingang zu kommen haben?
Der Geschäftsgang hier im GStA ist ja von meinem Amtsvorgänger sehr bedacht und sehr elaboriert eingerichtet worden. Allerdings leben wir inzwischen in einer digitalen Transformation, so dass diese Methode überprüft werden muss vor dem Hintergrund der Funktionalitäten, die uns die moderne Kommunikation bietet. Grundsätzlich ist das gar nicht so falsch, nur muss man überlegen, ob tatsächlich auf die Dauer jede Kommunikation, die ja wie ein Ping-Pong-Spiel ist, immer mit jeder E-Mail im Geschäftsgang aufschlagen muss – oder ob man da nicht sagen kann, jeder neue Vorgang wird registriert, aber alles, was da im Ping-Pong-Spiel weitergeht, nicht mehr. Ich habe der Versuchung widerstanden, zu sagen, wir machen das jetzt sofort anders. Wir werden im nächsten Jahr den gesamten Geschäftsgang überprüfen und ihn konzertiert mit der Einführung eines DMS (Dokumenten Management Systems) umstellen.
Ein weiterer Punkt ist, dass das GStA bisher relativ konsequent E-Mails nur in Form von PDF-Anhängen mit Briefkopfschreiben gemacht hat. Ich persönlich mache das nicht und auch meine Abteilungsleiter nicht mehr. Bevor wir das aber für das gesamte Haus umstellen, müssen wir bestimmte Dinge, die an diesem Geschäftsgang dranhängen, überprüfen und überlegen, wie wir diese anders regeln können, ohne dass bestimmte, bisher vorhandene Funktionalitäten wegfallen. Dazu gehört beispielsweise, dass diese PDFS in bestimmter Weise abgelegt und recherchierbar sind. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir das retten, auch wenn wir jetzt vielleicht andere Arten von Schreiben zulassen.
Das sind so die Fragen des 21. Jahrhunderts zu dem Thema: Wie archiviert man Digitales? Hätten Sie da auch eine Idee für Websites – also, wie man das Internet archiviert?
Das Grundproblem ist, dass digitale Daten, auch wenn man sie in einen Speicher schiebt, nicht einfach so weiterhin existieren. Es besteht immer die Gefahr, dass die Daten verlorengehen, weil diese elektronischen Dinge flüchtig sind. Inzwischen gibt es aber diverse Konzepte dazu, wie man digitale Daten archiviert. Das ist dann mehr als nur eine Langzeitspeicherung, sondern tatsächlich eine Archivierung.
Vor der Archivierung muss aber erstmal die Auswahl dessen getroffen werden, was man überhaupt aufbewahren möchte. Dann folgt ein relativ aufwändiges, technisches Verfahren, das die Daten in einer bestimmten strukturierten Umgebung ablegt. Die Daten sind nicht einmal da und bleiben so, sondern müssen immer wieder neu abgespeichert werden, damit sie über die Jahrzehnte erhalten bleiben. Das ist eine Herausforderung, vor der das Archivwesen seit einigen Jahren steht und wo jetzt so langsam erste Lösungen in Funktion treten. Wir müssen das für die stiftungseigenen Unterlagen natürlich auch machen, weil wir davon ausgehen, dass die Stiftung in absehbarer Zeit komplett auf digitale Kommunikation umstellt. Wir leben in einer Zeit, die man als „Hybrid“ bezeichnen kann, weil wir Papierform und elektronische Form nebeneinander haben – und allzu oft ist die elektronische Form überhaupt nicht strukturiert. Jeder hat seine E-Mails irgendwo liegen, die E-Mail-Anhänge irgendwo gesondert abgespeichert, da ist relativ wenig Strukturiertes dahinter. Hinzu kommt, dass die Sachen auch nur auf einzelnen Rechnern oder Servern liegen und wenn aber mal ein Server abgeschaltet wird, sind sie einfach weg.
Gleichzeitig werden aber immer noch Papierakten geführt, hier bei uns noch sehr gute, also sorgfältige. Anderswo sind jetzt aber schon ganze Teile nicht mehr unbedingt in den Papierakten nachzuvollziehen, weil die Disziplin, das auszudrucken, was in die Akten gehört, nicht immer da ist. Wir hoffen, mit dem DMS ein zukunftsfähiges Konzept voranzutreiben.
Es werden ja täglich Massen an E-Mails gesendet – das wird eine große Aufgabe.
Erstmal wird es natürlich eine große Aufgabe sein, alle Mitarbeiter in der Stiftung darauf zu schulen, dieses System auch anzuwenden. Das erfordert eine erhebliche Disziplin, weil bisher die ganze E-Mail-Korrespondenz nach Gefühl und Wellenschlag abgelegt wird. Die Einführung eines DMS bedeutet, dass ein ganz stark reglementierter Ablauf kommt. Dann wird ein Posteingang in allen Dienststellen der SPK in einer ganz bestimmten Weise bearbeitet und abgelegt. Das wird für viele sicherlich eine Umstellung sein. Aber das ist notwendig, damit man am Ende elektronische Akten hat.
Wir haben die Kolumne „Zauber des Anfangs“ in unserem Newsletter, bei der Neulinge im Preußischen Dienst gefragt werden, was Sie in ihren ersten Tagen glücklich gemacht hat. Was ist es bei Ihnen?
Da kann ich verschiedene Sachen angeben. Das eine ist, dass sich sowohl die Mitarbeiter im Haus als auch mein Amtsvorgänger sehr freundlich und aufgeschlossen gezeigt haben. Man hat mir den Beginn hier wirklich sehr leicht gemacht. Das Arbeiten macht natürlich Spaß, wenn die Leute mitgehen und eine Aufgeschlossenheit für Neuerungen da ist. Es ist immer einfach zu sagen, „wir müssen etwas ändern“, aber wenn man dann konkret wird, ist es nicht mehr ganz so einfach. Darum ist es natürlich sehr schön, wen man merkt, dass man gut aufgenommen und auch das, was man verfolgen möchte, positiv gesehen wird. Das Zweite ist, dass ich es sehr spannend finde, mich jetzt in einem Kulturkosmos zu bewegen. Vorher war ich ja in einem Archiv, das dem Innenministerium unterstanden hat, also sehr stark an die Verwaltung angebunden war. Das hat auch viele Vorteile, hat aber bedeutet, dass ich von der Kultur ein bisschen weg war. Und hier ist man auch dank der Sitzungen der SPK mittendrin in den großen Fach- und Kulturdiskussionen: Humboldt Forum, Bauakademie, Neue Nationalgalerie und so weiter. Das finde ich schon sehr spannend, da jetzt so mitten im Geschehen zu sein.
Haben Sie schon etwas Unerwartetes in den 35 Kilometern Akten des GStA gefunden?
Ich selber habe wenig Gelegenheit, die Akten anzuschauen. Aber die Mitarbeiter haben mir in diesen ersten, wirklich schönen Gesprächen interessante Bestände vorgeführt. Außerdem hatten wir letztens eine afrikanische Delegation zu Besuch, mit der wir zusammen geschaut haben, was an Überlieferungen zu den deutschen Kolonialstaaten in Afrika da ist – das ist ja schon spannend, was man hier so finden kann. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, sind die vielen Zeichnungen im Nachlass einer Fürstin im brandenburgischen Hausarchiv. Genaugenommen sind das Kunstwerke – also etwas, was man nicht unbedingt in einem normalen Archivbestand erwarten würde. Außerdem kam diese Dame aus Holland und da ich ja durch meinen ersten Lebensort Oranienbaum ein gewisses Interesse an holländischen Kulturbeziehungen habe, macht das für mich noch einen zusätzlichen Reiz aus.
Die Fragen stellte Gesine Bahr