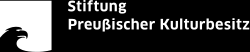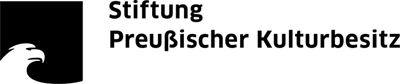SPK-Stiftungsrat stimmt zu: Verständigung der Öffentlichen Hand mit dem Haus Hohenzollern
News vom 26.05.2025
Eigentum an strittigen Beständen wird an privatrechtliche Stiftung übertragen – SPK gibt im Zuge einer Ausgleichsregelung Objekte ab – Parzinger: Den größten Gewinn von dieser Einigung haben die Museumsbesucher

Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter Vorsitz von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat am 26. Mai 2025 der Verständigung der Öffentlichen Hand mit dem Haus Hohenzollern über strittige Eigentumsfragen zugestimmt und den Präsidenten der SPK ermächtigt, alles Weitere zu tun, um diese Vereinbarungen umzusetzen.
SPK-Präsident Hermann Parzinger erklärt: „Die Einigung mit dem Haus Hohenzollern ist wirklich ein großartiger Erfolg im Sinne unserer Musemsbesucherinnen und -besucher. Sie profitieren davon am meisten, denn viele bedeutende Objekte sind damit nun endgültig und für immer für die Öffentlichkeit gesichert. Ich danke allen, die an diesem Verhandlungserfolg beteiligt waren – dem Haus BKM mit der vormaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth und dem jetzigen Amtsinhaber Wolfram Weimer, auch und ganz besonders dem früheren Amtschef Andreas Görgen, und den Ländern Berlin und Brandenburg. Dem Haus Hohenzollern und Georg Friedrich Prinz von Preußen und natürlich meinen Kollegen Christoph Vogtherr von der SPSG und Raphael Gross vom DHM.“
Seit den 1990er Jahren gab es Verhandlungen mit dem Haus Hohenzollern über die Rückgabe von Objekten, die sich in den Sammlungen der SPK, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sowie des Deutschen Historischen Museums befanden. Die Hohenzollern hatten im Zuge der deutschen Einheit Anträge nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz (EALG) gestellt. Es ging für die SPK dabei zunächst um Bestände aus dem Hohenzollernmuseum im Schloss Monbijou, die nach dem Krieg in die Sowjetunion abtransportiert worden waren und Ende der 1950er Jahre in die DDR zurückkehrten.
Im Laufe der Verhandlungen wurde immer deutlicher, dass hier komplexe Rechts- und Provenienzfragen im Raum standen, die ihren Ausgang bereits in der Weimarer Republik hatten. Schon 1925/26 war nämlich in dem sogenannten „Vermögensauseinandersetzungsvertrag“ nach dem Ende der Monarchie eine Vereinbarung darüber getroffen worden, was künftig staatliches Eigentum sein sollte und was Privatvermögen. In Bezug auf verschiedene Vermögenspositionen waren die Regelungen dieses Vertrages nicht klar gefasst und die Gesprächspartner konnten kein Einvernehmen erzielen, wem danach das Eigentum zustand. Über viele Jahre gab es in den Verhandlungen kaum Fortschritte, sieht man von der Erarbeitung und dem Austausch von speziellen Listen mit den streitigen Beständen einmal ab.
Die nun ausgehandelte Lösung sieht vor, dass zur Beilegung der Streitigkeiten eine privatrechtliche Stiftung gegründet wird, auf die das Eigentum an den streitigen Beständen übertragen wird. Stifter sind die Bundesrepublik Deutschland, die Länder Berlin und Brandenburg, die Stiftungen Preußischer Kulturbesitz und Preußische Schlösser und Gärten, das Deutsche Historische Museum und Georg Friedrich Prinz von Preußen. Die Stifter treten ihre Eigentumsansprüche an den streitigen Werken an die neue Stiftung ab. Den Vorstand der neuen Stiftung mit dem Namen „Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz“ bilden die Präsidenten der Stiftungen Preußischer Kulturbesitz und Deutsches Historisches Museum und der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Aufsichtsgremium der Stiftung ist ein Stiftungsrat, der mit sechs Vertretern der öffentlichen Hand und drei vom Haus Hohenzollern benannten Vertretern besetzt sein wird. Mit der finalen Vereinbarung sind sämtliche Ansprüche des Hauses Hohenzollern gegenüber den drei kulturgutbewahrenden Einrichtungen abgegolten.
Die SPK bringt 1685 Werke in die neue Stiftung ein. Darunter befinden sich u.a. bedeutende Porzellane wie das Tafelservice für das 1750 von Friedrich II. erworbenen Breslauer Stadtschloss, das eigens für diesen Standort 1767 in der erst kurz zuvor gegründeten Königlichen Porzellan Manufaktur Berlin (KPM) hergestellt wurde, Darüber hinaus handelt es sich um Möbel, Metallarbeiten, Ringe, Petschaften, Fächer, Elfenbeine, Musikinstrumente und einige Textilien. Künstlerisch und kulturgeschichtlich sind diese Artefakte von herausragender Bedeutung und lassen Querbezüge zu den Beständen des Kunstgewerbemuseums zu. Sie bilden seit Jahrzehnten einen integralen Bestandteil der dauerhaften Sammlungspräsentationen an beiden Standorten des Kunstgewerbemuseums (am Kulturforum und in Schloss Köpenick) und können nun weiterhin dort gezeigt werden.
Im Rahmen der gefundenen Lösung ist außerdem ist eine Ausgleichsregelung vereinbart, die vorsieht, dass das Haus Hohenzollern für den Verzicht auf seine Eigentumsrechte an den Objekten, die in die Stiftung eingebracht werden, bestimmte Objekte aus dem Altbestand des Hohenzollernmuseums zurückerhält. Im Wesentlichen betrifft dies kunsthistorisch weniger bedeutsame Objekte, bei denen die Museen bereits vor etwa zehn Jahren festgestellt hatten, dass sie abgegeben werden könnten, ohne den Sammlungsbestand wesentlich zu beeinträchtigen. Die SPK gibt insgesamt 2999 Einzelobjekte ab, darunter 2122 Münzen, für die im Bestand des Münzkabinetts jeweils Doubletten vorhanden sind, und persönliche Gegenstände wie Fächer, Kästchen, einzelne Porzellane und ähnliches. Daneben werden drei bedeutendere Objekte abgegeben werden. Dabei handelt es sich um einen Tisch mit Porzellanplatte nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel und Ludwig Hesse für die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) von 1832 sowie ein Brettspiel mit 30 Spielsteinen aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums. Außerdem gibt die SPK das Gemälde „Ansicht Potsdams vom Brauhausberg“ von Karl Lindemann-Frommel (um 1845) aus dem Bestand der Alten Nationalgalerie ab.
Weitere bedeutende Kunstwerke bleiben im Eigentum der SPK: So ist nun der Streit um die sogenannte „19er Liste“ mit insgesamt 19 Kunstwerken der SPK und SPSG von herausragender Bedeutung geklärt. Die Parteien vertraten unterschiedliche Auffassungen, ob diese dem Staat oder dem Haus Hohenzollern gehören. In den Sammlungen der SPK befinden sich von dieser Liste unter anderem die sogenannte Prinzessinnengruppe von Schadow und das Gemälde „Der Tanz“ von Watteau. Alle diese Objekte wurden nun eindeutig der öffentlichen Hand zugeordnet. Der Rahmenvertrag zu der vereinbarten Lösung sieht zudem vor, dass das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz weitere Archivbestände erhält, die sich heute auf der Burg Hohenzollern befinden. Das sogenannte „Burgarchiv“ enthält wesentliche Bestände zur preußischen Geschichte und zur Geschichte der Hohenzollern insbesondere im 20. Jahrhundert und wird künftig die bereits im Geheimen Staatsarchiv vorhandenen Überlieferungen zur Geschichte des Hauses Hohenzollern ergänzen, die überwiegend mit dem Fall der Monarchie um das Jahr 1918 enden.
Weiterführende Links
- Pressemitteilung: SPK-Stiftungsrat stimmt Verständigung der Öffentlichen Hand mit dem Haus Hohenzollern über strittige Eigentumsfragen zu (26.5.2025)
- Pressemitteilung (BKM): Vermögensauseinandersetzung mit dem Haus Hohenzollern nach fast 100 Jahren endgültig beigelegt – neue Stiftung sichert historisch bedeutsame Kunstgegenstände